In Folge des in der letzten Sitzung nochmal recht ausführlich (wenn auch natürlich nicht erschöpfend) besprochenen Arendt-Textes und der anschließenden Diskussion um Arendts Kritik an der Überlagerung des „Politischen“ durch das „Notwendige“, haben wir dann in Bezug auf Sennett zum Ende der Sitzung vor allem Gemeinsamkeiten mit Arendt und seine Sicht auf „das Politische“ gesprochen.
Sennett konzentriert sich aber, zumindest in diesem Kapitel gar nicht so sehr auf politische Fragen. Er beschreibt den Zustand des öffentlichen Lebens auch im alltäglichen Zusammenhang, anhand von zwischenmenschlichen Beziehungen oder einfach dem Aufhalten im öffentlichen Raum.
Er beschreibt einen öffentlichen Raum, der von schweigenden, beobachtenden „Raumdurchquerern“ mit einer Tendenz zum Narzissmus gefüllt ist, die denken ihre Sexualität und ihre Persönlichkeit wären etwas, dass gefunden werden müsste, anstatt etwas, dass sich in der Interaktion mit Anderen entwickelt. Sieht so der Archetyp des narzistischen „Raumdurchquerers“ aus?
Der letzte Aspekt hat mich besonders interessiert. Sennett beschreibt Erfahrung in der Öffentlichkeit als etwas, dass noch im „letzten Jahrhundert […] in einen Zusammenhang mit der Ausbildung der Persönlichkeit“ (S. 38) gestellt wurde. Sicher sagt das noch nichts darüber aus wie bedeutend dieser Zusammenhang sein mag, nicht einmal ob er überhaupt besteht. Allerdings kam in der letzten Sitzung auch das Phänomen zur Sprache, dass sich im eigenen Umfeld häufig Menschen befinden, die in wesentlichen Punkten schon ähnlicher Ansicht sind. Darüber hinaus konsumieren wir gerne Nachrichten die unserer politischen Agenda entsprechen, gehen in Seminare die dazu passen und schauen Filme und Serien in denen Dinge gezeigt werden die zu unserem Weltbild passen. Es gibt schon einen Grund dafür, dass die Komfortzone ihren Namen hat und dass eine Armee von „Persönlichkeitscoaches“ sich auf die Fahne geschrieben hat dich aus ihr rauszudrängen und sich dann dafür bezahlen zu lassen (solche merkwürdigen Typen). Das alles legt zumindest nahe, dass der größere Teil der Persönlichkeitsentwicklung in Auseinandersetzung mit Fremdem/Fremden zustande kommt.
Wenn man glaubt dass dieser Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrung in der Öffentlichkeit besteht, eröffnet sich eine neue Perspektive auf unser Seminarthema. Privatheit stellte sich auch bei den bisher behandelten Autoren schon immer als etwas wertvolles, schützenswertes dar. Nicht jedes Mal lag der Fokus darauf warum Privatheit überhaupt wichtig ist, aber das Streiten für gesetzliche Regelungen, der Versuch herzuleiten woher ein Recht auf Privatheit kommen könnte impliziert den Wert der Privatheit. Natürlich war bei den anderen Autoren mit denen wir uns befasst haben, öffentliches Leben nichts per se falsches oder gefährliches. Neu ist bei Arendt und Sennett allerdings die Anerkennung des öffentlichen Lebens als etwas, das auch einen Wert für das Leben des Menschen hat, das auch bestimmte Idealbedingungen hat und das auch von der Privatheit bedroht sein kann.
Wenn man das ernst nimmt lohnt es sich vielleicht nicht nur zu diskutieren, was Privatheit bedeutet, wieso das wichtig ist und wie man die am besten sicherstellt, sondern eben auch was an Öffentlichkeit wichtig ist, wie das am Besten gestaltet werden sollte und was da alles nichts zu suchen hat.
Die bei Sennett angesprochene Bedeutung der Begegnungen im öffentlichen Raum für die Persönlichkeitsentwicklung ist eher positiv gefärbt, schließlich hebt sich eine Gesellschaft die dieses Ideal teilt von dem von ihm kritisierten Intimitätskult ab. Es gibt allerdings auch Klassiker die diese Erfahrung kritisch sehen, ich denke das ist zumindest grob den meisten noch aus der Schule bekannt.


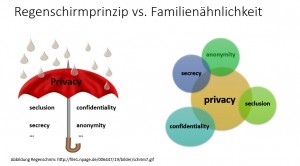

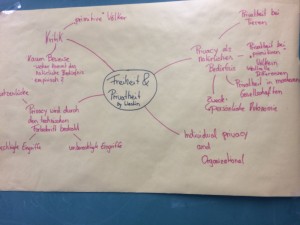
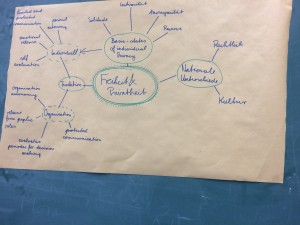

 Die
Die