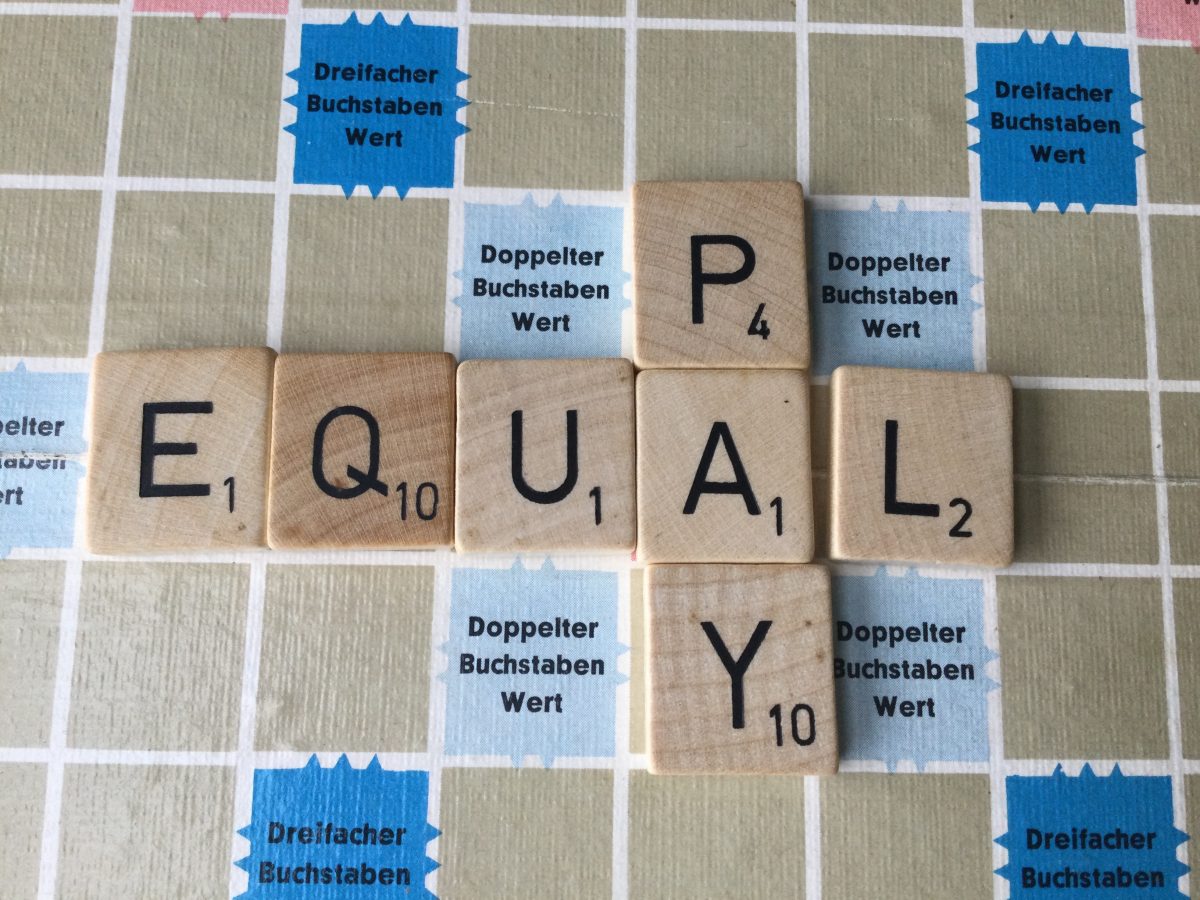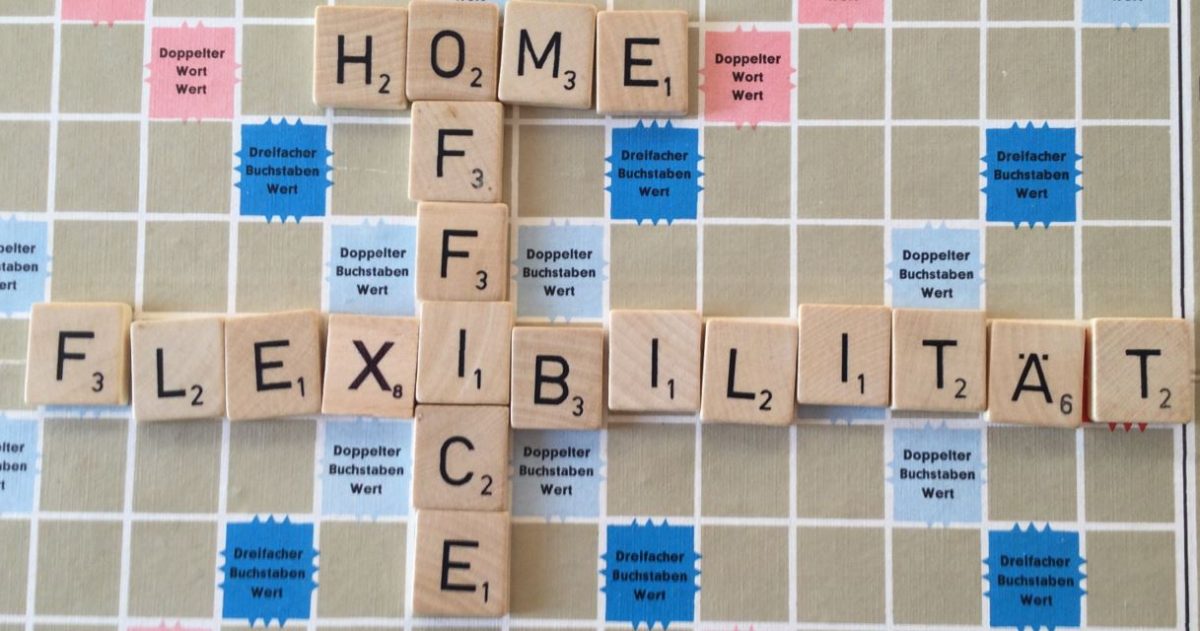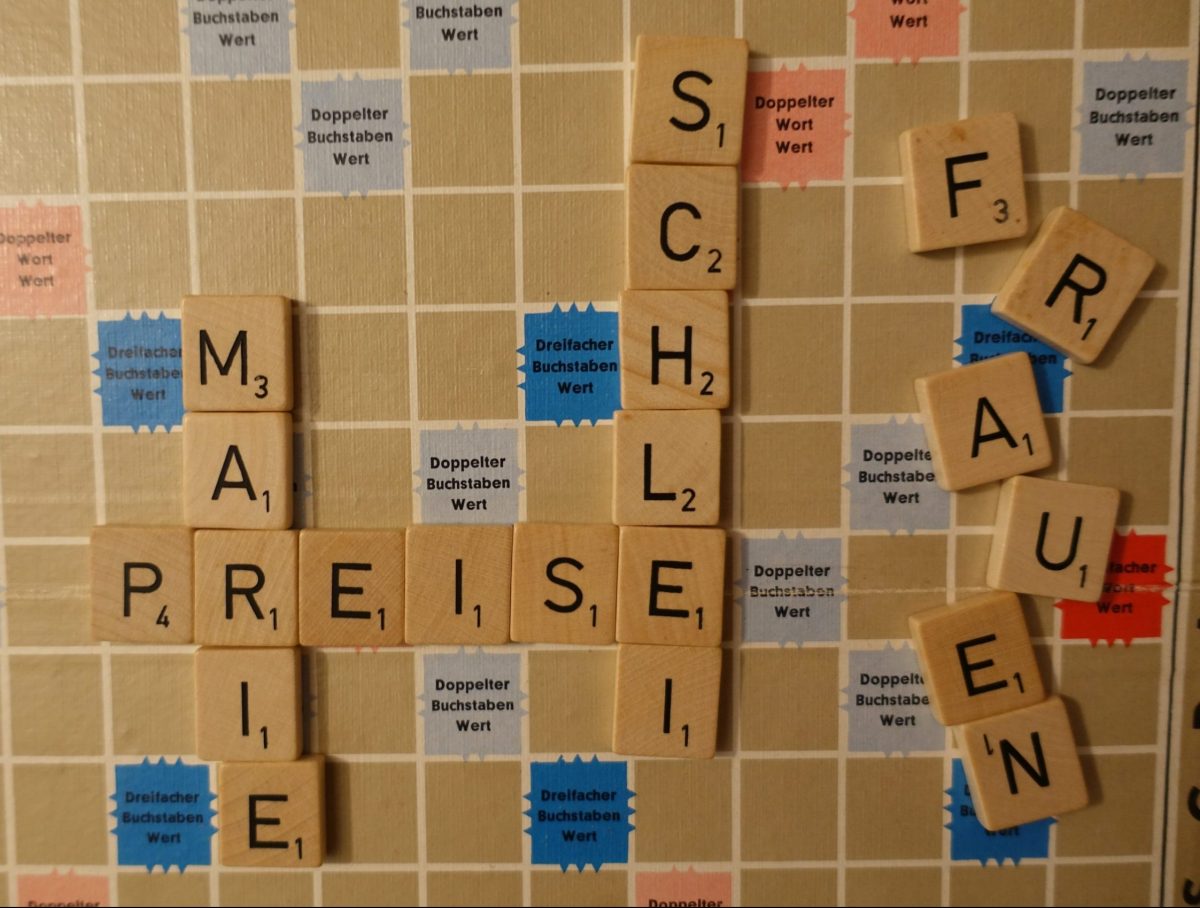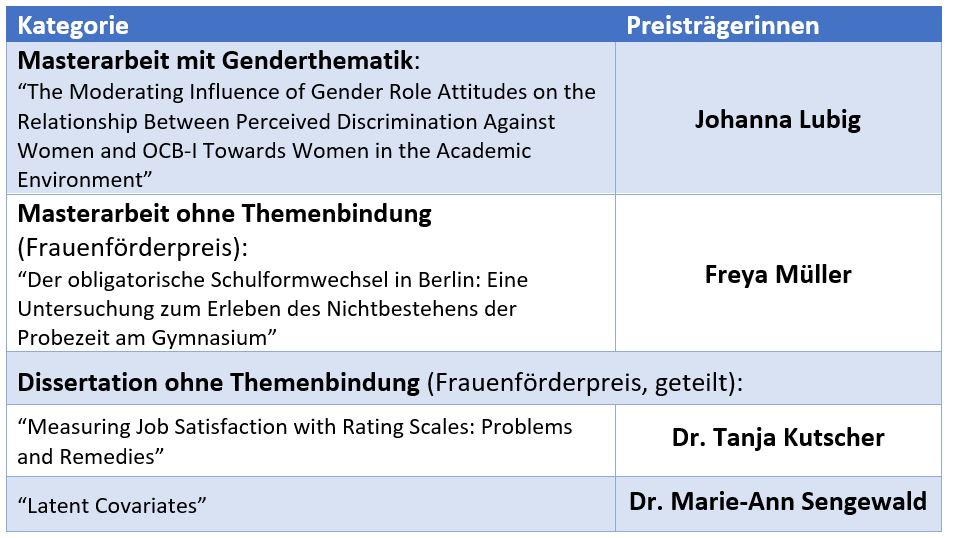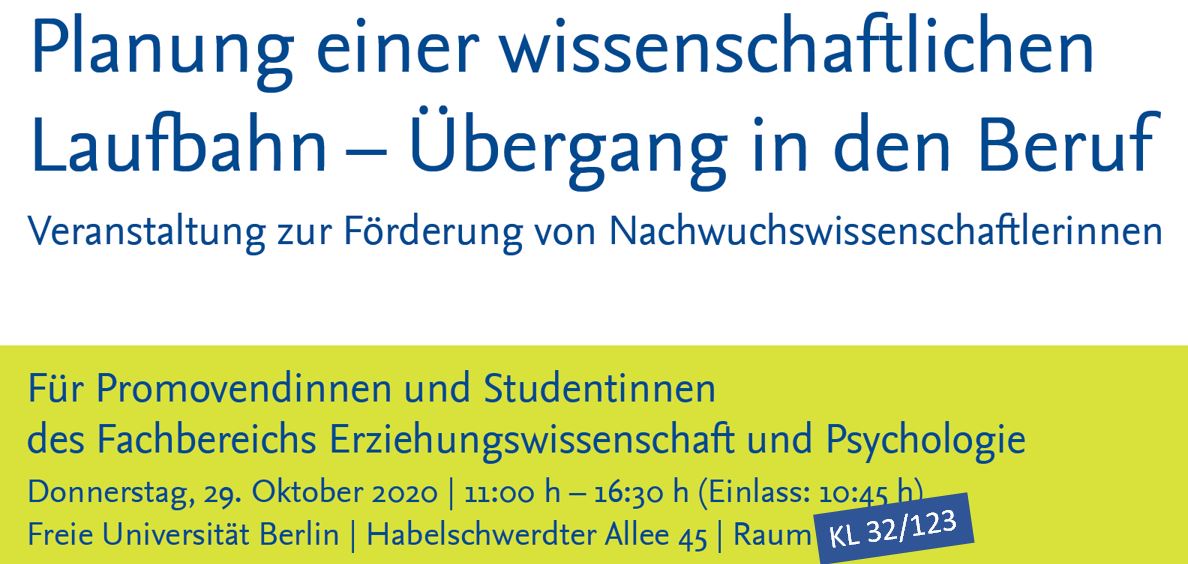Der Umstand, dass Studierende aktuell fast ausschließlich online am Unigeschehen teilnehmen, lässt den Blick nicht nur auf gelingende Lehre richten, sondern auch auf Begleitumstände und Folgen. So berichten 86% der befragten Studierenden einer umfassenden Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), dass in Zeiten der digitalen Semester der Aufbau und die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte zu Mitstudierenden schwieriger geworden sind (Marzuk et al., 2021). Ähnlich wurden fehlende Kontakte im Stimmungsbild 6/2020 unseres Fachbereichs nach dem ersten digitalen Semester in allen Statusgruppen beklagt. Vieles spricht dennoch dafür, dass die Möglichkeiten zum digitalen Austausch nicht nur zum Lernen und Diskutieren genutzt werden, sondern – infolge mangelnder Alternativen – auch zum Kennenlernen unter den Studierenden, v.a. bei den „Erstis“. Und das ist auch gut so. Aber müssen wir nochmal aufschreiben, wie wir uns „benehmen“?
Wie das Einmaleins des respektvollen Umgangs miteinander (auch) zum Werkzeug gegen Diskriminierung und Belästigung wird
Seit Juli 2020 haben wir es schriftlich: Der Code of Conduct der FU benennt nicht nur, dass alle Beteiligten in der digitalen Lehre respektvoll miteinander umgehen. Er konkretisiert das auch mit scheinbaren Banalitäten wie „Wir hören einander aufmerksam zu“ oder „Wir stellen das Mikrofon auf stumm, wenn wir einer Veranstaltung beitreten“ oder mit dem Hinweis, dass keinerlei Äußerungen/Verhaltensweisen geduldet werden, die unangemessene Inhalte verbreiten oder andere diskriminieren. Ja, klar, aber warum Selbstverständliches aufschreiben?
Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb!
Im aktuellen Welt-Mädchenbericht 2020 von Plan International (#FreeToBeOnline) wird v.a. eins deutlich: So doll lieb dann wohl doch nicht. 14.000 Mädchen und junge Frauen wurden in 22 Ländern weltweit zu ihren Erfahrungen in den sozialen Medien befragt; ihre Antworten sind ernüchternd. Jede zweite wurde bereits online belästigt, beschimpft oder bedroht; die Angaben zum Erstalter fangen bei acht Jahren an (Pehlke, 2020).
Quelle: https://www.plan.de/freedom-online.html
Auch wenn diese Ergebnisse selbstverständlich nicht 1:1 auf den universitären Alltag übertragen werden können oder sollen, müssen wir damit rechnen, dass auch an der Universität diskriminiert, beleidigt und belästigt wird. Grobes Fehlverhalten ist dabei relativ einfach einzuordnen. Schwieriger ist es, wenn die Grenze zwischen angemessenem und unangemessenem Verhalten nicht so deutlich ist. Sicherlich würde man zu Unrecht von (Cyber-)Stalking sprechen, wenn jemand nach einem unbeantworteten Kontaktversuch nochmal nachfragt (z.B. per Mail oder mittels eines Instant-Messaging-Dienstes). Wenn hingegen eine Beziehung wiederholt eingefordert wird, obwohl die Zielperson deutlich gemacht hat, dass sie den Kontakt nicht wünscht, könnte die Grenze erreicht sein. Zentral ist, dass die Lebensführung der Zielperson schwerwiegend beeinträchtigt wird, wenn sie sich also bedroht und belästigt fühlt. Und um genau so etwas nicht hinzunehmen, um Belästigte verteidigen und schützen zu können, brauchen wir den Code of Conduct!
CoC ist kein Knigge 3.0 – Verstöße können rechtliche Folgen haben!
Der Code of Conduct ist nämlich kein Knigge 3.0, dessen Benimmregeln man nach Lust und Laune befolgen kann (oder auch nicht …). Er ist verbindlich an der FU und wird von der FU-Richtlinie zum Umgang mit sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt ergänzt. Geklärt ist dabei, was passiert, wenn Personen sich nicht an diese Festlegungen halten. Bei gemeldeten Regelverstößen erfolgt zunächst eine Anhörung aller Betroffenen und es wird versucht, die Situation zu klären. Im nächsten Schritt können dann (in Abhängigkeit von Art und Ausmaß des Vorfalls/der Vorfälle) Konsequenzen gezogen werden, von schriftlicher Aufklärung/Absichtserklärung über Ausschluss von Lehrveranstaltungen und/oder Abmahnung bis hin zur Kündigung/Exmatrikulation und/oder Strafverfolgung.
Was ist zu tun?
Wenn Sie selbst betroffen sind:
- Überlegen Sie, mit wem Sie darüber sprechen möchten, und kontaktieren Sie diese Person oder Institution. Dieser Kontakt kann auch dann (sehr) sinnvoll sein, wenn Sie sich nicht so ganz sicher sind, was Sie von der Situation halten sollen.
- In jedem Fall können Sie z.B. die Dozierenden, das Dekanat oder die dezentrale Frauenbeauftragte kontaktieren. Weitere Anlaufstellen an der FU finden Sie hier. Externe Beratungsoptionen finden Sie zudem ganz am Schluss des Beitrags.
- Die Art der Kontaktaufnahme ist ebenfalls Ihnen überlassen: online, telefonisch oder ggf. per Videokonferenz; dabei kann online- und telefonische Beratung auf Wunsch auch anonym geschehen.
- Vertraulichkeit und Schweigepflicht sind für Berater:innen selbstverständlich!
Wenn Sie Zeug:in solcher Regelverstöße geworden sind:
- Schauen Sie hin und werden Sie aktiv!
- Machen Sie deutlich, dass Sie das inadäquate Verhalten nicht tolerieren.
- Bieten Sie der betroffenen Person Ihre Unterstützung an.
- Überlegen Sie (falls sinnvoll), wie Sie sich mit ihr solidarisieren können (unter Berücksichtigung der Wünsche der betroffenen Person).
- In manchen Fällen – wenn die betroffene Person z.B. gar nicht weiß, dass ihre Persönlichkeitsrechte verletzt werden – kann es auch notwendig sein, den Vorfall zu melden.
Bevor Sie eine private Chat-Gruppe zu Studienzwecken bilden (mit welchem Dienst auch immer):
Prüfen Sie, ob es nicht genauso ein User-Wiki oder ein User-Blog der FU tut, also eine der sog. „inoffiziellen“ Plattformen der FU, die auch von Studierenden genutzt werden können. Dann nämlich kann die FU als Institution bei Bedarf (Regelverletzungen) auch juristisch aktiv werden!
Hilfe und Beratung gibt es hier (eine Auswahl):
- Bundesweites Hilfetelefon für Frauen, die Gewalt erlebt haben: 0 8000 116 016
- Externe Chatberatung: https://www.hilfetelefon.de/ (u.a. Beratung in 17 Sprachen und Gebärdensprache)
(Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben)
- Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe:
https://www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de/de/
- Die Beratungsstelle Stop-Stalking berät (a) Betroffene von Stalking, (b) Menschen, die stalken, sowie (c) Dritte, die beruflich oder als Angehörige mit Stalking zu tun haben: https://www.stop-stalking-berlin.de/de/home/
Quellen
Marczuk, Anna, Multrus, Frank, & Lörz, Markus (2021). Die Studiensituation in der Corona-Pandemie. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Lern- und Kontaktsituation von Studierenden. (DZHW Brief 01|2021). Hannover: DZHW. https://doi.org/10.34878/2021.01.dzhw_brief
Pehlke, Viktoria (2020). Jedes zweite Mädchen wird im Internet belästigt. Katapult. [https://katapult-magazin.de/de/artikel/jedes-zweite-maedchen-wird-im-internet-belaestigt]
Plan international (2020). Free to be online? [https://www.plan.de/freedom-online.html]