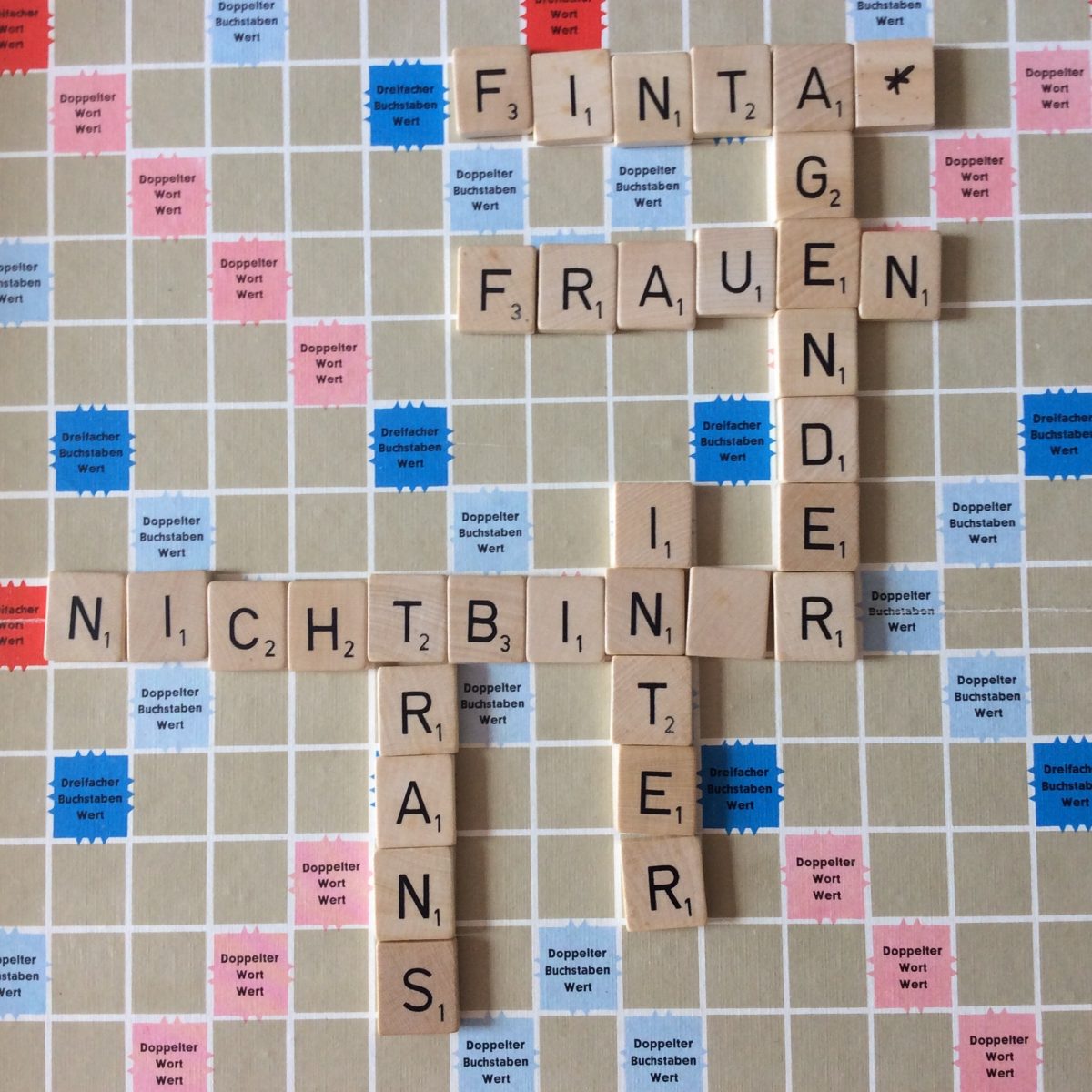In der Öffentlichkeit wie in der Fachliteratur wird häufig von Work-Life-Balance gesprochen, was jedoch inhaltlich aus mehreren Gründen problematisch ist: Der Begriff suggeriert, dass Arbeit nicht wirklich zum „Leben“ dazugehöre und dass privat nicht gearbeitet werde; Familienarbeit wie Haushalt, Pflege von Angehörigen und Kindererziehung, ehrenamtliche Tätigkeiten u.ä. werden hier ignoriert, obwohl zu vermuten ist, dass sich diese Aspekte auf das Erleben einer Balance auswirken. Demgegenüber kann festgehalten werden, dass in beiden Bereichen Anforderungen und Verpflichtungen sowie Interessen und Bedürfnisse eine wichtige Rolle spielen und sich auf das Erleben einer Balance auswirken können (zsfd. hierzu auch Blahopoulou, 2012). Daher bevorzuge ich den Begriff der Life-Balance.
Life-Balance umfasst noch weitere Facetten; sie kann sich nämlich auf sehr unterschiedliche Dinge beziehen: auf tatsächlich verbrachte Zeit, auf psychische und körperliche Anforderungen und Beanspruchungen, auf die Erreichung von persönlichen Zielen und und und … Bei einer gestörten Life-Balance wird oft vermutet, dass sich das Berufsleben negativ auf das Privatleben auswirkt (manchmal auch umgekehrt). Diese gegenseitige Beeinflussung wird fachlich auch gern mit Spillover betitelt und sie kann – das wird häufig vergessen – natürlich auch positiv sein: So kann eine Person z.B. von ihren im Privatleben erworbenen Organisationskompetenzen auch beruflich profitieren.
Eine Vielzahl von Rollen und Funktionen wird oft mit einer (Über-)Belastung assoziiert, obwohl ebenfalls argumentiert wird, dass Menschen von vielfältigen Rollen profitieren und Ressourcen aufbauen können. Die Frage ist m.E. weniger, welche der beiden Hypothesen zutrifft, als vielmehr, unter welchen Bedingungen die eine und wann die andere gilt.
Grenzgänger*innen
Susan Campbell Clark (2000) hat dazu eine Theorie über die Grenzen zwischen Arbeit und Familie formuliert und Erwerbstätige als Grenzgänger*innen bezeichnet. Sie hat z.B. Hypothesen dazu aufgestellt, unter welchen Bedingungen z.B. sehr starke Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben sinnvoll und hilfreich sind für eine gelungene Life-Balance und wann nicht. Die Stärke der Grenzen wird der Theorie zufolge durch ihre Durchlässigkeit[1] und Flexibilität/Starrheit bestimmt und soll eine zentrale Rolle für die Life-Balance spielen. Clark vermutet, dass starke Grenzen sich dann positiv auswirken, wenn Arbeits- und Privatleben sich in vielen Dimensionen unterscheiden; bei großen Ähnlichkeiten hingegen sollen schwache Grenzen positiv erlebt werden. Wenn Grenzen nur in eine Richtung durchlässig sind, aber nicht in die andere[2], dann ist eine stärkere Identifikation mit dem besonders stark „geschützten“ Bereich hilfreich, um eine positivere Life-Balance zu erleben. (Im unten genannten Beispiel wäre es also vorteilhaft für die betroffene Person, sich besonders mit ihrem Beruf zu identifizieren.) Ob eine Trennung von Arbeit und Privatleben zu empfehlen ist, hängt demnach von den Umständen ab. Dabei ist der Einfluss der betreffenden Person auf die Festlegung der Grenzen ebenfalls relevant: Je mehr die Grenzen selbst beeinflussbar sind, desto positiver fällt die Life-Balance aus.

Aktuell wird auch im akademischen Arbeitskontext besonders spürbar, dass „zu Hause arbeiten“ oftmals mit sehr schwachen, durchlässigen Grenzen einhergeht. Gerade diejenigen, die aktuell keinen eigenen, ungeteilten oder aber keinen ruhigen Raum zum Arbeiten haben, wissen die sonst selbstverständlichen Grenzen zum Büro oder zur Ruhe der Bibliothek in der Uni ganz neu zu schätzen (siehe auch Facts des Monats Mai). Es wird auch deutlich, dass „zu Hause arbeiten“ die ganze Vielfalt von Arbeit umfasst: Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung, Betreuung von erkrankten oder pflegebedürftigen Menschen, Haushalt, …
Klar ist, dass Life-Balance immer wieder neu gefunden werden muss, erst recht in dieser Zeit. Wie es Ihnen aktuell damit ergeht und wie Sie die letzten Wochen erlebt haben, interessiert uns ganz besonders und wir laden Sie ein, uns gern dazu ein kurzes Statement, ein Foto oder kurzes Video zu schicken (schreiben Sie uns: Frauenbeauftragte EwiPsy). Wenn Sie das zusätzlich erlauben, machen wir Ihren Beitrag auch gern anderen Angehörigen des Fachbereichs zugänglich!
Literatur
Blahopoulou, J. (2012). Work-Life-Balance-Maßnahmen: Luxus oder Notwendigkeit? Organisationale Unterstützung und ihre Auswirkungen. München: Hampp.
Clark, S.C. (2000). Work/family border theory: A new theory of family/work balance. Human Relations, 53(6), 747-770.
[1] Unter einer durchlässigen Grenze versteht sie, dass Elemente des jeweils anderen Bereichs präsent sind (z.B. Familienfotos auf der Arbeit, Anrufe von der Arbeit nach Hause usw.).
[2] Beispiel: Wenn das Privatleben auf der Arbeit in keiner Weise präsent ist und die Arbeitszeiten nicht an private Bedürfnisse angepasst werden (können), die betreffende Person jedoch zu Hause stets beruflich zu erreichen sein muss, spräche man davon, dass die Grenze der Arbeit sehr stark/undurchlässig und die des Privatlebens eher schwach/durchlässig wäre.