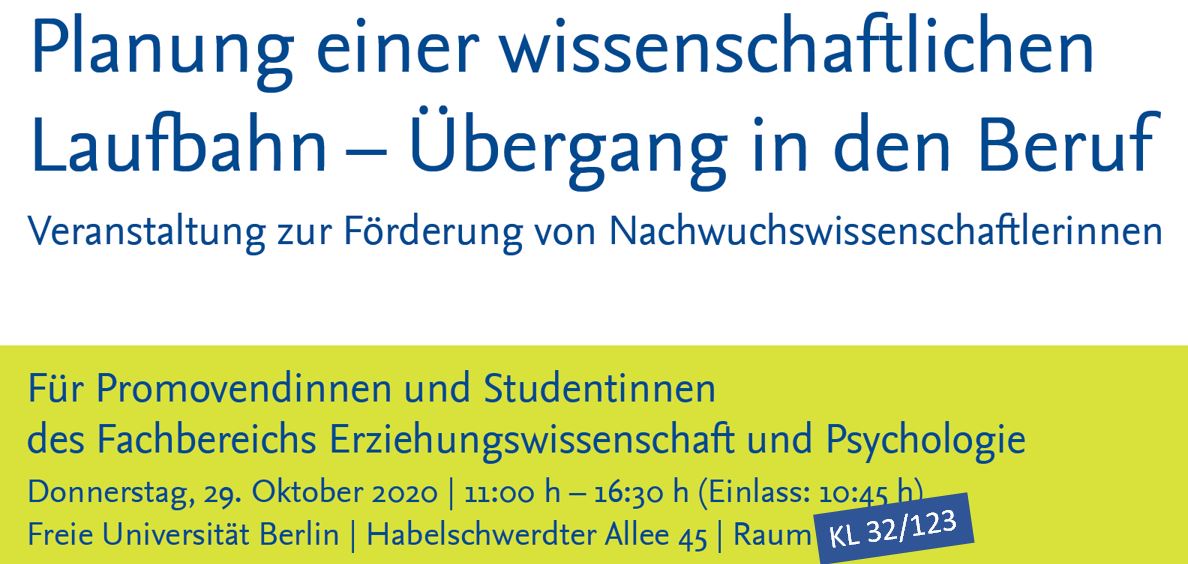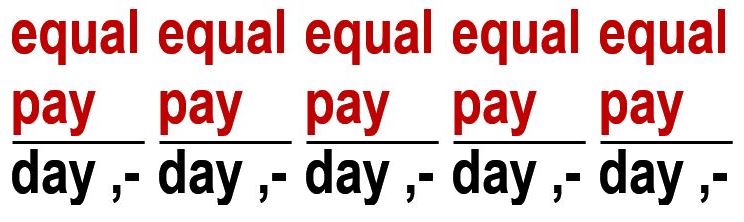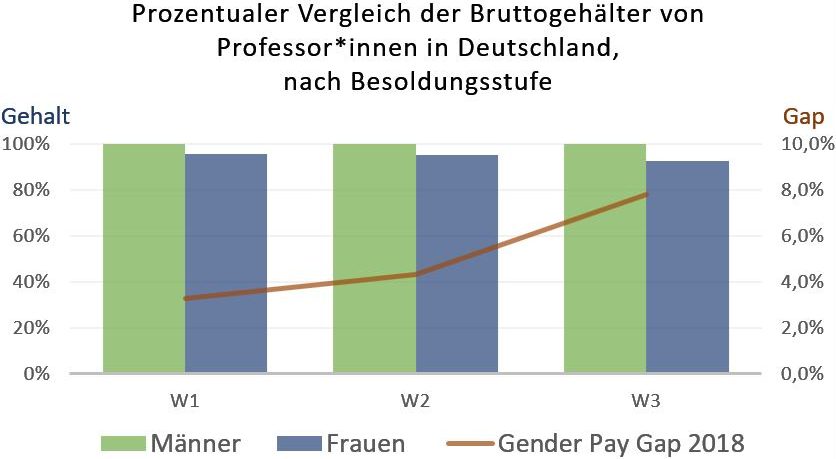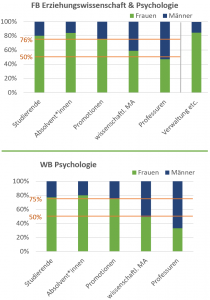Gibt es Rassismus in Deutschland denn überhaupt noch so wirklich?
Eine Stellungnahme von Leonie A.
In den letzten Wochen und Monaten ist die Debatte um Rassismus durch verschiedene Ereignisse, insbesondere auch durch den Tod von George Floyd verstärkt in den Blick der deutschen und internationalen Gesellschaft gerückt, so der Eindruck zumindest, wenn man sich die mediale Berichterstattung der letzten Zeit ansieht.
Der Ist-Zustand der Gesellschaft, in der wir hierzulande tagtäglich unserer Leben gestalten, der Ist-Zustand unserer institutionellen Systeme, der diese Gestaltung maßgeblich beeinflusst, wird von vielen scheinbar „erst jetzt“ oder auch „jetzt mal wieder“, nicht selten auch explizit abwertend „jetzt schon wieder“ als diskriminierend und insbesondere rassistisch „entlarvt“.
Es ist absolut richtig und wichtig, dass das Thema Rassismus angesprochen wird. Dabei ist es meiner Meinung nach jedoch besonders wichtig, konkret darüber zu sprechen, dass Rassismus hier bei uns im System steckt! Nicht woanders. Nicht nur in den USA, nicht nur bei der Polizei. Rassistische Sozialisierung ist tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und lenkt bewusst und unbewusst unser Denken, unsere Sprache und unser Handeln.
Diese Sozialisierung führt dazu, dass Konstrukte über Herkunft und Nationalität, über Zugehörigkeit und Anderssein existieren und immer und immer wieder reproduziert werden. Die daraus resultierenden rassistischen und diskriminierenden Zuschreibungen erschweren und gefährden tagtäglich das Leben vieler Menschen bis auf den Tod.
Sie betreffen konkret das Leben von Menschen, die dem Bild der Dominanzgesellschaft nicht entsprechen. Dieses Bild ist jedoch so stark, dass sich kleine, deutsche Schwarze Mädchen (ja, es gibt sie haufenweise!) wünschen, wie Claudia Schiffer aus der Fernsehwerbung auszusehen, damit ihr Leben leichter wird. Dieses Bild ist so stark, dass Schwarze deutsche Väter ihren Kindern beibringen, wie sie sich bei einer Polizeikontrolle zu verhalten haben, ihnen eintrichtern, dass sie immer mehr geben und immer besser sein müssen als ihre weißen Freund*innen, um die gleiche Anerkennung und die gleichen Bildungschancen zu erlangen. Dieses Bild ist so stark, dass Menschen auf Grund ihrer äußeren Erscheinung bespuckt, beschimpft, geschlagen und getötet werden. Das sind keine Einzelfälle, das sind keine persönlichen Probleme, das ist bittere, alltägliche Realität in Deutschland, das ist ein Zeugnis von tief verwurzeltem Rassismus.
Deshalb ist die Frage, ob Rassismus in Deutschland überhaupt (noch) eine Rolle spielt, in meinen Augen ein Zeugnis der Unwissenheit oder Ignoranz, in jedem Falle jedoch ein Zeugnis der Privilegien der Fragenden. Denn warum und von wem wird diese Frage so laut und oft gestellt, wenn die Antwort darauf doch von so vielen schon so oft mit einem eindeutigen und schmerzhaften JA, verdammte Scheiße beantwortet wurde? Warum dreht sich die Debatte immer noch vorrangig darum, ob und wie genau Rassismus vorliegt, wenn seit Jahren strukturelle Daten und empirische Erkenntnisse über die Situation in Deutschland und zahlreiche Berichte von Betroffenen vorliegen? Warum liegt der Fokus darauf, wie wir diese Debatte führen, und nicht darauf, wie wir diese Debatte lösen? Die viel wichtigere Frage sollte inzwischen doch sein:
Wie können wir Rassismus bekämpfen?
Ich denke, dazu brauchen wir strukturelle, tiefgreifende Veränderungen auf verschiedensten Ebenen, und zwar am besten jetzt. Denn es kann nicht sein, dass Kinder im Zoo Berlin durch die Scheibe ins Affengehege gedrückt werden, weile weiße Erwachsene der Meinung sind, sie gehören dahin. Es kann nicht sein, dass ich mich jedes Mal für meine Herkunft rechtfertigen muss, wenn ich gefragt werde, woher ich komme. Es kann nicht sein, dass man von mir verlangt, mich mit anderem Namen vorzustellen, nur weil mein eigener zu schwierig ist. Das Problem ist nicht der Name, die Herkunft, das Aussehen. Das Problem ist ein anderes und das muss klar erkannt, benannt und bekämpft werden, und zwar vor allem von denen, die eben nicht direkt Betroffen sind, denn wer mit offensichtlichem „Migrationshintergrund“ in Deutschland aufwächst und lebt, weiß schon lange, dass Rassismus in Deutschland existiert und wie er sich anfühlt und wird daran auch regelmäßig erinnert. Die Ob-Frage ist demnach überflüssig und mehr noch: Sie behindert eine progressive Auseinandersetzung mit möglichen Lösungen.
Doch was bedeutet das jetzt? Wie finden wir Lösungen?
Für mich persönlich bedeutet das, dass ich trotz all der Wut, all der Enttäuschung und Fassungslosigkeit, all den Stimmen sowohl in meinem eigenen Kopf als auch in meinem Umfeld, die an der zarten Hoffnung auf systemische Veränderung laut und kritisch zweifeln, mich aktiv zu positionieren, politisch aktiv zu werden und dafür meine zugeschriebenen Positionen zu nutzen.
Da die Welt eben nicht nur schwarz und weiß ist, habe ich in diesem System trotz Schwarzer Haut auch Privilegien, wie z.B. den deutschen Pass oder den Zugang zu einer bedeutenden Hochschule und einem akademischen Umfeld, welche ich im Kampf für eine gerechtere Welt einsetzen kann.
Es reicht nicht, nur zu sagen „ich bin nicht rassistisch“ oder „ich bin für eine gerechtere Welt“. Denn letztendlich bestimmt nicht das, was ich über mich sage, sondern mein Tun und Handeln mein Sein.
Es lässt sich nicht leugnen, wir leben (noch) in einer Gesellschaftsform, die Menschen mit unterschiedlichem Aussehen unterschiedliche Chancen gewährt. Dieses System wird sich nicht von selbst ändern, sondern nur, wenn sich die Menschen, die darin leben, ändern und Veränderungen fordern. Wir müssen subjektiv an das Thema herangehen und von innen heraus die Ketten des Rassismus sprengen. Wenn jede*r, aber insbesondere die, die dem Bild der Dominanzgesellschaft entsprechen, seine*ihre Position inklusive der zugehörigen Privilegien in diesem System nicht nur erkennt, sondern auch nutzt, um sich für rassismuskritisches Sprechen, Denken und Handeln stark zu machen, und laut Gerechtigkeit fordert, dann werden sich zwangsläufig auch die diskriminierenden Strukturen ändern. Und auch wenn nicht alle Menschen in Deutschland persönlich Opfer von Rassismus werden, so betrifft es eben doch alle, die hier leben und sich als Demokrat*innen verstehen, denn Minderheitenrechte sind grundlegend in unserer Demokratie verankert.
Es ist also an der Zeit weiterzudenken und daraus Konsequenzen für das alltägliches Handeln zu ziehen:
A better world is possible!
05.07.2020
Leonie A.