„Bring schöne Blog-Ideen mit!“ riefen mir meine Kollegen hinterher, als ich vor Kurzem zu einer Konferenz aufbrach. Um mich wieder mit Neuigkeiten in der Forschung zu Kreolsprachen zu versorgen und meine Ideen über Plurizentrik und die ABC-Inseln mit der Fachcommunity in der Kreolistik zu diskutieren, war ich beim Colloque International d’Études Créoles auf Guadeloupe. Nicht der schlechteste Ort, um im November eine Woche aus dem Berliner Grau zu entkommen, nur: Was hat Guadeloupe mit Niederländisch zu tun?
Natürlich waren die Niederländer zu Kolonialzeiten überall unterwegs und der eine oder andere Missionar oder Sklavenhändler kam auch hier vorbei (mehr dazu gibt es z.B. in der Masterarbeit von Carl Pruneau aus Montréal). Sprachliche Hinterlassenschaften schien es aber keine zu geben, im Unterschied zum kurzen britischen Interregnum. Das sorgt mit ein paar Ortsnamen wie Baimbridge oder Birmingham bis heute für Überraschungen auf den Straßenschildern. Das Niederländische ist besser getarnt.
Beiläufig fragte ich eine Kollegin auf der Konferenz, was eigentlich ein pitre sein sollte. Die größte Stadt der Insel (nicht aber die Hauptstadt) heißt nämlich Pointe-à-Pitre. Was für eine Spitze (pointe) gab der Stadt ihren Namen? Die Antwort: Es habe da einen niederländischen Juden gegeben, der aus Brasilien nach Guadeloupe gekommen sei. Was er da tat, ist genauso unklar wie seine genauen Lebensdaten. Dieser Pieter jedenfalls habe einem Fleckchen Land seinen Namen gegeben, genau an der Nahtstelle der beiden Inseln, die heute Guadeloupe bilden. Mitten im Herz des Schmetterlings, als den man Guadeloupe auf der Karte erkennen kann, und damit günstig gelegen als geschützter Hafen und zentraler Knotenpunkt der Kolonie. Weil das Französische so gerne Metathesen mag, soll daraus Pitre geworden sein – Pietersspitze also.
Das Problem an der Sache, wie so oft mit Toponymen: Es gibt keinerlei Nachweise für die Geschichte und daneben existieren einige andere mögliche Erklärungen, die weitaus weniger farbenfroh sind. Die Legende vom Zuckerrohrbauer oder Fischer namens Pieter klingt schön, ist aber womöglich frei erfunden.
Schade, dachte ich. Und war umso erstaunter, als ich einen relativ aktuellen Artikel in der taz über Guadeloupe las. Zur Sklavereigeschichte (die im neuen Mémorial ACTe seit 2015 eindrucksvoll dokumentiert wird) heißt es in dem Artikel: „Brutal wie die Züchtigungsinstrumente, die Peitschen, Stöcke und Ketten der Bastiaans, der schwarzen Aufseher, die sich in den Dienst der Sklavenhändler stellten.“
In Suriname ist der Begriff Bastiaan historisch geläufig, und er hat eine interessante Etymologie, nämlich vom englischen overseer über Sranan als basya schließlich reanalysiert als niederländischer Eigenname Bastiaan. Bestimmt kein besonders schönes Lehnwort, aber eine Spur! Bloß eine, die vor Ort offenbar niemand kannte. Der Begriff schien auf der Insel niemandem geläufig zu sein und er ist auch im Zusammenhang mit Sklavereigeschichte im frankophonen Internet nicht aufzufinden. Also offenbar nur ein Transfer im Rahmen umfangreicher transkolonialer Bildung der taz-Autorin.
Fazit: Das Niederländische findet man auf Guadeloupe höchstens vom Hörensagen. Und darauf kann es schon sehr stolz sein, denn das Deutsche scheint mit noch viel niedrigeren Bekanntheitsgraden zu kämpfen. Ein junger Mann fragte mich, welche Sprache man in Deutschland spreche. Meine Antwort, man spräche dort Deutsch, überraschte ihn sehr: „Ich dachte, da spricht man Englisch. Ist das nicht dasselbe?“ Vielleicht hätte ich einfach sagen sollen, dass wir einen ostniederländischen Dialekt sprechen.



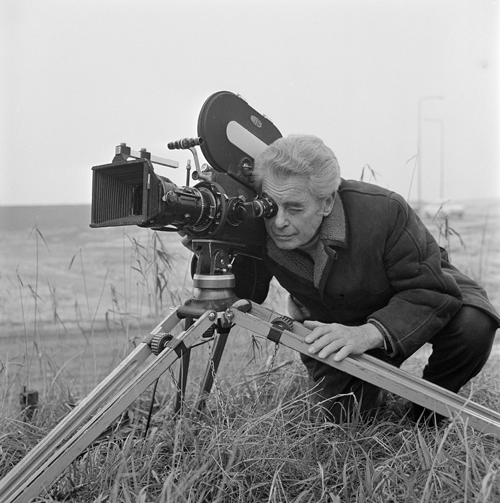
 Koffie en warme chocolade: dat is Nederlands.
Koffie en warme chocolade: dat is Nederlands.







 Die
Die