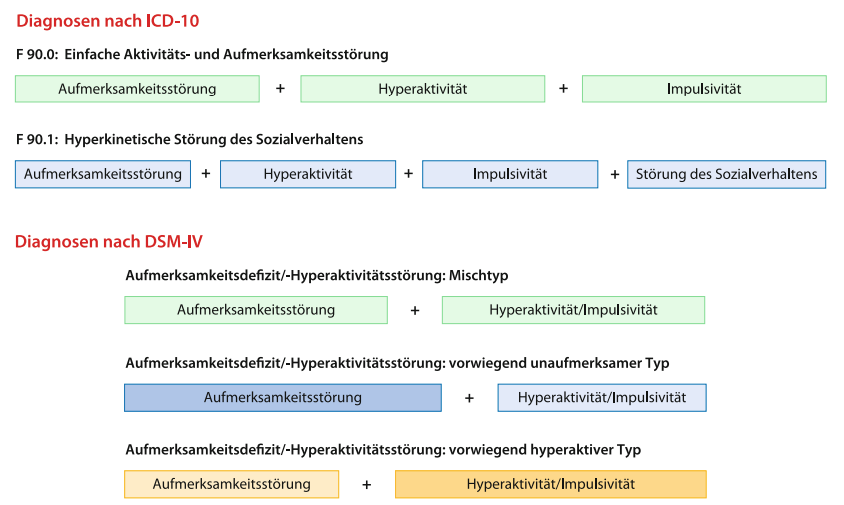Ein Essay.
Anonym (SoSe 2022)
Nicht jedes Jahr in den Urlaub fahren, die Bücher von der Schule gestellt bekommen, Anträge stellen um mit auf Klassenfahrt zu können. So sah meine Lebensrealität aus und im Studium geht es weiter: keine großen Auslandsaufenthalte, kein unbezahltes Praktikum annehmen können, nach Berlin pendeln, da Wohnen hier so teuer ist, die Berliner- Mieten stemmen zu müssen, nur ein weiteres Problem, ein weiterer Stressfaktor wäre.
Während meine KommilitonInnen für all diese Dinge Ressourcen zur Verfügung haben, diese Sorgen in ihrem Leben keine Rolle spielen, plane ich beim Stundenplan-Erstellen meinen Nebenjob fest mit ein, kann dabei nicht so frei wählen, wie ich will und für ein unbezahltes Praktikum ist auch keine Zeit. Es sind kleine Unterschiede, denen ich mir zuvor nie richtig bewusst war. Dass auch ich von Klassismus betroffen bin, habe ich erst richtig im Seminar verstanden. Auch wenn ich diese Unterschiede gemerkt habe, waren sie kein großes Thema oder ich wollte sie nicht an mich heranlassen. Schließlich komme ich so ja auch klar. Ich tue nur einfach immer mehr, kämpfe immer mehr, um das, was ich will und erreichen mag, weil ich das alles allein stemmen muss.
Ich habe mich nie richtig ausgeschlossen gefühlt, aber auch nie richtig dazugehörig. Das ist genauso unangenehm. Vielleicht weil es subtiler ist, weil dich niemand wegstößt und direkt ablehnt. Vielleicht weil du immer denkst, das hat etwas mit dir zu tun, du bist nicht genug, du bist nicht richtig. Dabei kannst du gar nichts dafür. Aber Klassismus, also diese kleinen feinen Unterschiede, machen es so einfach dich selbst in Frage zu stellen, dich mit Personen zu vergleichen, die eine ganz andere Lebensrealität haben, an die du nicht so einfach herankommst, mit der du nicht aufgewachsen bist. Am Ende hat mich Klassismus gelehrt, stark zu sein, stark sein zu müssen. Mich zu positionieren, durchzukämpfen, meine Stärke ist harte, ehrliche Arbeit und damit kann ich meine Ziele erreichen.
Das Ganze erst so spät zu verstehen, ist schwierig. Es hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen, mich ganz anders auf mein Leben zurückblicken lassen. Im Seminar habe ich schließlich nicht nur gelernt, dass Klassismus existiert und mich betrifft, sondern auch, dass das Thema lange ignoriert wurde. Zwar erklärt das, wieso ich zuvor nie wirklich etwas davon gehört habe, wirklich fair finde ich das aber nicht. Klassismus ist nicht einfach nur ein Thema für Uniseminare, sondern ein Diskriminierungsgrund, ein real existierendes Problem, das Ungleichheiten erzeugt. Ein Problem, über das AkademikerInnen schreiben und forschen, während ArbeiterInnen sich klein und wertlos fühlen. Ein Problem unserer modernen Gesellschaft, dem mehr Aufmerksamkeit zuteilen werden sollte.
Auch Andreas Kemper macht sich für diese Auffassung stark. Er führt an, dass – laut dem dritten Antidiskriminierungsbericht – die soziale Herkunft neben dem Geschlecht die wirkungsmächtigste Querschnittskategorie ist.[1] Als weiße cis Frau kann ich dem nur zustimmen. In der Caleidoscopia-Übung zu Beginn des Seminars haben die Kategorien Geschlecht und soziale Herkunft bei mir die ersten beiden Plätze eingenommen, da ich ansonsten viele Privilegien genieße.
Welche Diskriminierungserfahrungen ich als Frau mache, welche Benachteiligungen ich dadurch erfahre, möchte ich im Folgenden nicht weiter thematisieren, da es sich zum einen mit vielen überschneidet, was bereits bekannt ist und ich in diesem Essay einen Fokus auf Klassismus als gesellschaftliche Unterdrückungsform werfen möchte. Auch wenn Kategorien sich immer wieder überschneiden und Mehrfachdiskriminierungen erzeugen, eine gewisse Intersektionalität nicht zu vernachlässigen ist, entscheide ich mich hier ganz bewusst über Klasse, Klassenherkunft- und -unterschiede zu schreiben. Denn dieser wirkungsmächtigen Kategorie wird noch zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Ein Grund dafür könnte sein, dass es Ende der 1990er Jahre ohne weitere Diskussionen im Zuge der Amsterdamer Verträge als Diskriminierungsmerkmal entfernt wurde und seitdem nicht wieder aufgenommen wurde.[2] Weitere Gründe wie Diskriminierung aufgrund des Alters, der sexuellen Orientierung und körperlicher Behinderung sollte im Zuge der Amsterdamer Verträge ebenfalls entfernt werden, wurden jedoch wieder aufgenommen.[3]
Wieso die soziale Herkunft nicht? Wieso soll diese keine Rolle spielen, wenn dadurch eine Abwertung und eine Abgrenzung stattfindet? Wie Francis Seek betont, ist Klassismus nichts anderes als die Aufrechterhaltung und Legitimierung von sozialer Ungleichheit in unserer Gesellschaft.[4]
Der Begriff, um dieses Diskriminierungsmerkmal zu beschreiben, ist bereits vorhanden und das nicht erst seit Kurzem. Er existiert seit über hundert Jahren. Erstmals tauchte er 1974 bei der US-amerikanischen Gruppe „The Furies“ auf. Auch in Deutschland organisierten sich in den 1970er- und 1980er-Jahren Arbeiter_Innentöchter an Hochschulen. In den späten 80er-Jahren bildeten sich Prolesben-Gruppen, die Strategien gegen soziale Ungleichheit und ein Umverteilungsfond für Lesben in prekären Situationen einrichteten.[5] Klassismus ist demnach kein neuer Begriff, er wurde in der Breite nur nicht zur Kenntnis genommen.
Anknüpfend an diese ersten Gruppen für eine antiklassistische Praxis führt Andreas Kemper eine Bestandaufnahme für Deutschland an. Neben den feministischen Selbstorganisationen gibt es die sogenannten Social Justice Trainings, die als Empowerment für Menschen aus den benachteiligten Gruppen dienen sollen sowie für privilegierte Menschen, um eine Sensibilisierung zu schaffen. Hier wird Klassismus als ein Modul gelernt, neben weiteren Diskriminierungsformen wie Sexismus, Heterosexismus und Antisemitismus. Als weiteren Bereich nennt Kemper die antiklassistische Bildungspolitik. Dazu zählt er die WCPCA-Verteiler, die aus der US-amerikanischen Gruppe „Working Class/Poverty Class Academics“ entstand. Dabei handelt es sich um E-Mail-Verteiler, von AkademikerInnen mit einer Herkunft aus der ArbeiterInnenklasse. Nachdem der jährlich stattfindende Kongress zur Bildungsbenachteiligung/Klassismus 2011 vom Fikus-Referat an der Uni Münster ausgerichtet wurde, etablierten sich auch in Deutschland WCPCA-Verteiler. Seither existieren über 60 deutschsprachige.[6]
Hier endet die Bestandsaufnahme von Kemper, da er folglich nur noch von Perspektiven und Maßnahmen reden kann, die getroffen werden sollten. Fehlende Maßnahmen, offene Baustellen, die zeigen, wie wenig Beachtung Klassismus entgegengebracht wird. Es erscheint wie eine traurige Selbstironie, wenn ein Institut für Klassismusforschung nicht genügend finanzielle Ressourcen besitzt. Und es wird deutlich, was für ein blinder Fleck Klassismus in Institutionen und im Schulbereich ist, wenn Maßnahmen gegen Diskriminierung existieren und sogar Projekte wie „Schule gegen Rassismus“ entstehen, diese aber nicht auf Klassismus übertragen oder angepasst werden.
Eine antiklassistische Praxis in Deutschland existiert bereits und verweist darauf, dass Klassismus ein Problem ist, eine Diskriminierungsform, der wir – genauso wie anderen Formen der Unterdrückung und Benachteiligung von Menschen – nachgehen und bekämpfen müssen.
Welche Aktualität Klassismus besitzt, betont Seek, als sie auf die Coronapandemie verweist. Während die Wirtschaft eingebrochen ist, haben Milliardäre weltweit ihr Vermögen um 60% gesteigert und auch die zehn reichsten Deutschen haben im Coronajahr 2020 eine Steigerung ihres Vermögens um 35% gegenüber dem Vorjahr verbucht. Die Armutsquote liegt bei 15,9% und ist damit so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.[7] Dabei sind die Langzeit-Auswirkungen von zwei Jahren Pandemie noch nicht Mal im vollen Maße spürbar.
Doch die Zahlen verdeutlichen bereits jetzt, dass auch vor dem Coronavirus nicht alle Menschen gleich sind. Über diese Unterschiede, über diese Zahlen, die Klassismus auf dem Silbertablett servieren, ist jedoch wenig bekannt, wird wenig berichtet. Denn Klassismus ist – gegenüber anderen Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus – weitgehend unbekannt. Auch wenn Andreas Kemper und Heike Weinbach bereits über zehn Jahren eine Einführung in das Thema Klassismus veröffentlichten, passierte erst etwas, nachdem literarische und autobiografische Bücher erschienen sind. Von Einzelschicksalen zu erfahren, funktionierte nicht nur in den Massenmedien, sondern auch hier besser, brachte dem Thema mehr Aufmerksamkeit und ein besseres Verständnis entgegen. So konnten sich alle – privilegierte Menschen sowie benachteiligte – mehr darunter vorstellen, dem noch eher unbekannten Begriff etwas zuordnen beziehungsweise endlich einen Begriff haben, der alles beschreibt und ihn mit Wissen füllen oder eigenen Erfahrungen.
Es funktionierte auch bei mir. Der Einstieg ins Seminar mit autobiographischen Texten war augenöffnend, hat den ganzen diffusen Erfahrungen, die ich gemacht habe und nicht so recht einordnen konnte, die ich damals nicht so recht verstand, einen Spiegel vorgehalten. Es ist so wie Arslan meint: „Ich glaube als Arbeiter*innen-Kind, dass man aus der Person der Betroffenen schon sehr viel reflektiert. Du hast einfach den Blick von unten.“ [8]
Mir fiel es leicht mich in den Beschreibungen von den unterschiedlichen Autor*innen wiederzufinden. Zum Beispiel berichtet Stengele über ihre Klassenherkunft, erzählt wie sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, im Studium keine unbezahlten Praktika annehmen konnte und auf eine Notlösung zurückgreifen musste, beschreibt damit auch die Unterschiede zwischen ihr und den anderen Studierenden. Zudem beschreibt sie einen Entfremdungsprozess von ihrem bisherigen Umfeld und wie sich ihre Ansichten und ihre Sprache verändert haben.[9] Jedes Mal, wenn ich meine Familienmitglieder über meine Hausarbeiten lesen lasse, spüre ich diese Unterschiede, wie fremd ihnen diese akademische Sprache ist und was ich da eigentlich tue. Wenn ich mit anderen Studierenden rede, in der Mensa zusammensitze, spüre ich ebenfalls Unterschiede. Ich kann nicht so einfach länger studieren, mir noch Zeit lassen, da ich auf Bafög angewiesen und damit an die Regelstudienzeit gebunden bin. Zwar teilen wir auch viele Erfahrungen, können uns austauchen, werde ich in einigen Punkten besser verstanden, kann mich und meine akademische Sprache entfalten, aber uns trennen dennoch verschiedene Welten. So wie Stengele hat meine Klassenherkunft mein Leben geprägt und tut es immer noch. Ich bin mitten in diesem Entfremdungsprozess, stehe zwischen den Stühlen, gehöre in beide Welten, meiner Heimat und der der akademischen Lehre, nicht (mehr) recht hin. Durch die Texte, das Seminar und die gesamte Auseinandersetzung mit dem Thema Klassismus habe ich gelernt, dass das Ganze, dieser Prozess, nicht einfach nur etwas mit dem Erwachsenwerden zu tun hat, der Tatsache, dass ich nächsten Sommer meine Bachelorarbeit schreibe und dann wieder ins Ungewisse trete. Nein, es ist meine Klassenherkunft, die mir diese Erfahrungen einbringt, mich diese Unterschiede spüren lässt, mich unpassend für die Stühle macht.
Am meisten konnte ich mich mit den Schilderungen von Barbara Blaha identifizieren. So wie bei ihr ist irgendwie immer aufgefallen, dass wir mit fünf Kindern viele sind, dass diese Familiengröße nicht ganz üblich ist. Bei dem Besuch von SchulfreundInnen sind mir auch Kleinigkeiten aufgefallen, die ich als Kind einfach erstmal nur registriert habe. Ich habe die besseren Einrichtungen gesehen, die teuren technischen Geräte und das meine FreundInnnen sich ihre Zimmer nicht mit den Geschwistern teilen mussten. Meine Mutter ist alleinziehend und neben den Klamotten meiner Geschwister, die ich getragen habe, haben wir auch welche geschenkt bekommen. Das kannten die anderen nicht, das gab es bei denen nicht. Auch meiner Mutter war mein schulischer Erfolg nicht so wichtig, sie hat mir da nie Druck gemacht. Ihr war es immer nur wichtig, dass es mir gut geht, dass ich glücklich werde.[10] Mich mit Baha zu identifizieren, war so einfach, da auch für mich das „Lesen ein sehr großer Punkt ist“[11]. Ich habe immer gern und viel gelesen und gehe begeistert in meine Literaturseminare, fühle mich in der Germanistik gut aufgehoben. Ich bin die einzige meiner Geschwister, die studiert. Zwei von ihnen haben ebenfalls begonnen, aber wieder abgebrochen. Somit bin ich die Einzige, die einen Universitätsabschluss in Sichtweite hat. (Ein ganz komisches Gefühl, dass auf einmal so aufzuschreiben, weil ich mich dadurch nicht anders oder besser als sie fühle.)
Neben den Erfahrungen, die auch Blaha schildert, wie sich ständig darum zu kümmern, welche soziale Unterstützungsmöglichkeiten man beantragen kann, sind es auch die Empfindungen, die übereinstimmen und die sie so treffend beschreibt. Denn es ist ein permanenter Stress, ein Gefühl nicht ganz hierherzugehören, „ein Gefühl grundsätzlicher Überforderung“ [12]. Tatsächlich will ich mich aber gar nicht groß beklagen, habe nicht das Gefühl, dass es mir so schlecht ging. Denn wir hatten alles, was wir brauchten, für unsere Grundversorgung war gesorgt. Auch ich habe oft gehört, dass wir uns etwas nicht leisten können, dass etwas zu teuer ist, früh gelernt was Sparen ist und gelernt mich in Wünschen, die Konsumgüter betreffen, zurückzunehmen. Aber: „Es war mehr das Gefühl, dass wir zwar keine Kohle haben, aber es ist trotzdem okay“ [13]. Wir hatten immer zu Essen, ein Dach über den Kopf, unsere Schulbildung. Das hat alles geklappt, das hat uns allen auch zugestanden.
Ich will mich nicht groß beklagen, da meine Klassenherkunft mich schließlich vieles gelehrt hat, mir vor allem beibrachte, wie ich ganz allein stark sein muss, wie stark ich sein kann. Ich wusste es ja, habe es immer gespürt, dass ich andere Voraussetzungen hatte und habe und ich daher immer mehr strampeln muss, mich selbst organisieren und somit extrem selbständig werden musste. Doch das ist auch, wie Blaha betont, eine starke Antriebskraft, zu wissen, ich habe das ganz allein gemacht, ich habe das alles allein geschafft.
Ja, ich spüre das und ich schätze das sehr, doch ich merke auch, dass meine KommilitonInnen geübter darin sind, das Wort in sozialen Situationen zu ergreifen, dass sie mehr freie Zeit zur Verfügung haben, Zeit und Geld haben in den Ferien lange Urlaub im Ausland zu machen. Und inzwischen, da bin ich mir ziemlich sicher, merke nicht nur ich das, sondern auch die anderen. Auch meinen privilegierten Mitstudierenden fällt auf, dass es Unterschiede gibt. Ich erinnere mich gut an die Situation, als ich mit einem Freund zusammen in der Mensa saß, der mit mir Germanistik an der FU studiert und er meinte, er wüsste gar nicht wie er das alles manchmal machen soll, wenn er noch arbeiten gehen müsste, so wie ich. Während er seine Hausarbeiten immer wieder aufschiebt, als Altlasten mitschleppt, plant sich mehr Zeit fürs Studium zu lassen, so sieben vielleicht auch acht Semester, bin ich dazu angehalten, dass alles schnell zu erledigen, da ich Arbeit noch einplanen und mir meinen Stundenplan in jedem Semester vollhauen muss, da ich in sechs Semestern abschließen sollte, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Er zieht den Hut vor mir. Einen Hut, den ich mir niemals aufsetzten kann, da er mir nie passen wird.
In diesem Gespräch, durch all meine Erfahrungen im Leben und im Seminar habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, darüber zu reden. Ich will das tun, das ganze Thema nicht unsichtbar werden lassen. Ich will weiterhin lernen mit anderen ins Gespräch zu kommen, mich auszutauschen und meine Erfahrungen zu berichten.
Die soziale Herkunft und Lage prägen unser Leben, unsere Ansichten, unsere Sprache, Möglichkeiten und Voraussetzungen, die Art, wie wir mit Geld umgehen, wie wir von unserem zukünftigen Leben träumen. Klassismus bildet eine Diskriminierungsform, einen Grund sich ausgeschlossen zu fühlen, Benachteiligungen zu erfahren oder von seinen Privilegien zu profitieren. Demnach bin ich dafür, diesen Ismus als eine Art der Diskriminierung anzuerkennen und sich darüber zu bilden sowie Maßnahmen gegen Klassismus zu entwickeln und zu fördern.
[1] vgl. Andreas Kemper. 2018. Die vergessene Benachteiligung. Warum Klassismus ein eigenständiges Diskriminierungsmerkmal sein sollte, S.2.
[2] vgl. ebd. S.1.
[3] vgl. Friedrich Ebert Stiftung. Landesbüro Thüringen (Hrsg.). Andreas Kemper 2016. „Antiklassistische Praxis in Deutschland“. In: Klassismus. Eine Bestandsaufnahme, S.20.
[4] vgl. Francis Seek 2022. Klassismus. Die ignorierte Diskriminierungsform. In: Dies. Zugang verwehrt, S.13.
[5] vgl. ebd. S.17-18.
[6] vgl. Andreas Kemper 2016. „Antiklassistische Praxis in Deutschland“. In: Klassismus. Eine Bestandsaufnahme, S. 16.
[7] vgl. Francis Seek 2022. Klassismus: Die ignorierte Diskriminierungsform. In: Dies. Zugang verwehrt, S.15.
[8] Zeyneb Arslan 2021. Ich will dahin, aber ich komme nicht rein. In: Bettina Aumair/Brigitte Theißl (Hrsg.). Klassenreise. Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, S. 142.
[9] vgl. Julischka Stengele 2021. Ich habe einen hohen Preis bezahlt. In: Bettina Aumair/Brigitte Theißl (Hrsg.). Klassenreise. Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, S.167-170.
[10] vgl. auch Blaha, Barbara 2021. Arbeiter*innen sind nicht die besseren Menschen. In: Bettina Aumair/Brigitte Theißl (Hrsg.). Klassenreise. Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, S.53- 59.
[11] ebd. S. 60.
[12] ebd. S.63.
[13] ebd. S.64.
Quelle: Anonym, Wieso Klassismus als Diskriminierungsform anerkannt werden sollte. Ein Essay, in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 22.11.2022, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=316