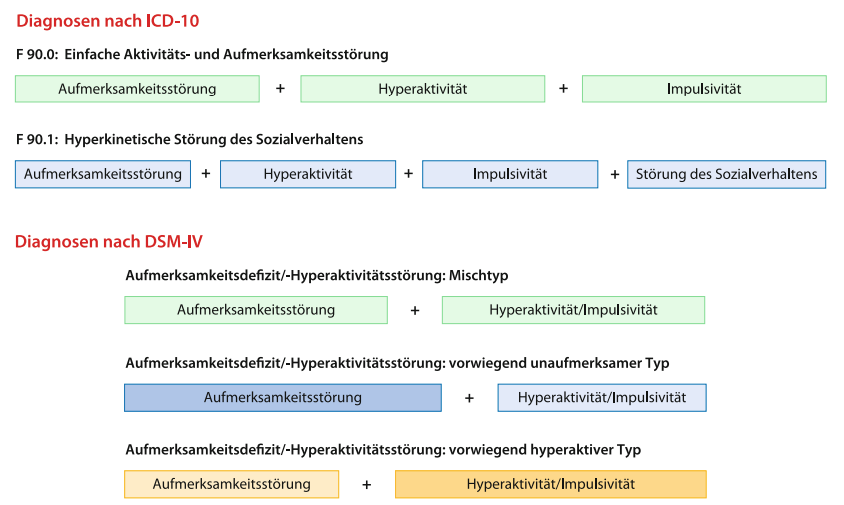Atanasova Polina (S0Se 2023)
Einleitung
Die Gesundheitsversorgung ist ein grundlegendes Menschenrecht, das jedem Individuum unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft gleichermaßen zugänglich sein sollte. Dennoch offenbart die Realität, dass die geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung mit einer Vielzahl von Herausforderungen und Defiziten konfrontiert ist.
Historisch gesehen hat die Medizin den männlichen Körper als universelles menschliches Modell verwendet.[1] Dabei wurden anatomische Abbildungen, Symptom-Beschreibungen, diagnostische Verfahren und Therapien ohne Berücksichtigung anderer Geschlechter entwickelt. Dies führte zu einer unangemessenen medizinischen Versorgung für Frauen*[2] und Minderheitsgruppen[3], die häufig vernachlässigt oder stigmatisiert wurden.
Obwohl es Fortschritte bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Reduzierung der Stigmatisierung gibt, sind Frauen* und LGBTQ*-Personen nach wie vor einem besonderen Maß an Unsichtbarkeit, Diskriminierung und Ungerechtigkeit ausgesetzt.
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, die Herausforderungen im Gesundheitswesen zu schildern, denen Frauen* und LGBTQ*-Personen gegenüberstehen. Dabei liegt der Fokus auf den verschiedenen Faktoren und Erfahrungen von Frauen* und LSBTQ*-Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit ihrer sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt.
1. Die medizinische Pathologisierung von Frauen*
Traditionelle Annahmen über Männlichkeit und Weiblichkeit haben im gesellschaftlichen Bewusstsein gewisse Asymmetrien in den Vorstellungen über beide Geschlechter gefestigt. Diese Geschlechterasymmetrien äußern sich hauptsächlich in stereotypen Geschlechterbildern, die sowohl negative Vorstellungen über das andere Geschlecht als auch positive Selbstbilder auf der Grundlage bestimmter Merkmale einschließen können. Solche stereotypen Vorstellungen über das Verhalten beider Geschlechter sind das Ergebnis historisch gewachsener sozialer Rollenverteilungen.[4] Historisch betrachtet wurde der männliche Körper als Norm angesehen, während der weibliche Körper als abweichend und pathologisch erklärt wurde.[5]
Wie von Karin Nolte betont wird, bleibt diese Wahrnehmung auch in der Gegenwart hartnäckig bestehen:
„Bis heute prägen Geschlechterkonzeptionen der Medizin des 19. Jahrhunderts Wahrnehmungen von Weiblichkeit und Krankheit in unserer Gesellschaft, die nach wie vor auf der Vorstellung einer dichotomen Geschlechterordnung basieren.“
[6]
Die Pathologisierung von Frauen* in der Medizin hatte verschiedene Konsequenzen: Fehl- oder Überversorgung im Bereich der Medikalisierung durch Psychopharmaka; Vernachlässigung spezifischer Gesundheitsbedürfnisse; Stigmatisierung, sowie Unterrepräsentation von Frauen* in klinischen Studien.[7] In der Tat, obwohl geschlechtsspezifische Unterschiede in Symptomatik und Krankheitsverlauf nachgewiesen sind, werden klinische Studien häufig nur an männlichen* Probanden durchgeführt und Diagnosekriterien, Behandlungsmöglichkeiten sowie Medikamentendosierungen sind hauptsächlich auf Männer* ausgerichtet.[8] Weiterhin zeigen internationale Studien[9], dass Schmerzen bei Frauen* häufig unterschätzt oder nicht ernst genommen werden, insbesondere wenn die Schmerzen nicht mit anderen Symptomen einhergehen.[10]
Nicht nur in der Forschung, sondern auch in der medizinischen Praxis werden nicht alle Körper gleichwertig behandelt. Besonders betroffen von dieser Ungleichbehandlung sind Frauen*, die als nicht weiß gelesen werden: bei ihnen überlagern sich sexistische und rassistische Vorurteile, was oft zu einer besonders schlechten medizinischen Versorgung führt.[11]
Weitere Diskriminierungsrisiken aufgrund der sexuellen Identität betreffen vor allem nicht-heterosexuelle und nicht-cisgeschlechtliche Menschen. Dies kann auf mangelnde Sensibilität und Stereotypen seitens medizinischen Personals, Diskriminierung und Stigmatisierung sowie Zugangsbarrieren zu speziellen medizinischen Dienstleistungen zurückgeführt werden.[12]
All diese Aspekte werden genauer erläutert, und es wird auf die spezifischen Erfahrungen von Frauen* und LGBTQ*-Menschen in Deutschland eingegangen. Zuvor ist es jedoch wichtig, kurz zu definieren, was unter geschlechtsspezifischer Medizin zu verstehen ist.
2. Geschlechtsspezifische Medizin
Die geschlechtsspezifische Medizin (auch als Gendermedizin bekannt) untersucht die Auswirkungen von biologischen und soziokulturellen Geschlechteraspekten auf Prävention, Entstehung, Diagnose, Therapie und Forschung von Krankheiten. Ihr Hauptziel besteht darin, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu optimieren.[13]
Dieses Teilgebiet der Humanmedizin entstand in den 1970er Jahren als Reaktion auf die internationale Frauengesundheitsbewegung. Anfangs lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf den Gesundheitsproblemen von Frauen*, doch im Laufe der Zeit hat sich ein ausgewogenes Interesse an der Erforschung anderer Geschlechter etabliert.[14]
Dank der geschlechtsspezifischen Medizin konnte ein stark ausgeprägter Geschlechterunterschied bezüglich des Gesundheitsgeschehens nachgewiesen werden, d. h., in der Morbidität (Krankheitshäufigkeit) und der Mortalität (Sterberate). In den Entstehungsprozessen von Krankheiten sowie den Krankheitsverläufen und im Gesundheitsverhalten scheinen Männer* und Frauen* sich signifikant zu unterscheiden.
Es muss jedoch beachtet werden, dass die Medizin in ihrer Definition von Gender[15] immer noch ein dichotomes, normiertes zweigeschlechtliches Verständnis nutzt: das Forschungsfeld konzentriert sich vorrangig auf die Binarität der Geschlechter Mann* und Frau*. Studien zu trans* und queeren Personen sind in diesem Bereich selten anzutreffen.[16]
Es lässt sich also konstatieren, dass die geschlechtsspezifische Medizin eine bedeutsame und vielversprechende Disziplin darstellt, welche das Potenzial besitzt, die Gesundheitsversorgung erheblich zu optimieren. Indem geschlechtsspezifische Unterschiede in Betracht gezogen werden, können genauere Diagnosen und individualisierte Behandlungen ermöglicht werden, was zu verbesserten Ergebnissen für die Patienten führt. Des Weiteren trägt die geschlechtsspezifische Medizin dazu bei, gezieltere Präventionsstrategien zu fördern.
Dennoch ist es auch unbestreitbar, dass der geschlechtsspezifischen Medizin gewisse Herausforderungen gegenüberstehen. Eine nähere Erläuterung dieser Herausforderungen folgt im anschließenden Abschnitt.
3. Probleme und Barrieren der gesundheitlichen Versorgung
In unserem alltäglichen Wissen wird die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen sowie die von Geburt an festgelegte Geschlechtszugehörigkeit (und größtenteils die damit verbundene Heterosexualität) in der Regel als selbstverständlich und natürlich akzeptiert und praktiziert.[17] Dennoch handelt es sich bei der Geschlechtskategorie um ein sozial strukturelles und sozial konstruiertes Phänomen, das historisch und gesellschaftlich geformt ist und in sozialen und alltäglichen Interaktionen sowie Handlungen reproduziert wird.
Geschlecht klassifiziert Individuen in zwei unterschiedliche Gruppen, basierend sowohl auf biologischen Zuordnungen als auch auf gesellschaftlichen Zuschreibungsprozessen.
Demzufolge liegt das Problem dieser Ausrichtung an zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen in der Gesundheitsversorgung hauptsächlich darin, dass es spezifische Benachteiligungen aufgrund der geschlechtlichen und sexuellen Identität verursacht.[18]
Wie bereits zuvor kritisch angemerkt wurde, werden Frauen* in medizinischen Studien oft nicht angemessen berücksichtigt, während nicht-binäre Personen, die sich außerhalb des traditionellen Geschlechterspektrums identifizieren, mit unzureichender Anerkennung und Sensibilisierung seitens Gesundheitsdienstleistern konfrontiert sind. Dies führt zu geschlechtsbezogenen Datenlücken, erschwertem Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, Schwierigkeiten bei geschlechtsangleichenden Maßnahmen, psychischen Gesundheitsproblemen und sozialer Stigmatisierung.
Diese Probleme verdeutlichen die Notwendigkeit einer geschlechtsbewussten und LGBTQ* inklusiven Herangehensweise in der Medizin, um eine gerechtere und effektivere Gesundheitsversorgung für Frauen* und LGBTQ*-Menschen sicherzustellen.
Im Folgenden werden wir uns in den kommenden beiden Abschnitten konkret mit Daten und Erfahrungen bezüglich der Gesundheitsversorgung von Frauen und LGBTQ*-Menschen in Deutschland auseinandersetzen.
3.1 Erfahrungen von Frauen*
Laut des RKI-Berichtes zur gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland[19] von 2020 sind Frauen* häufiger von psychischen Störungen – vor allem von Depression, Angststörungen und Essstörungen – betroffen als Männer*:
„Bei der Entstehung psychischer Störungen spielen biologische, psychische und soziale Faktoren eine Rolle und werden als Gründe für bestehende Geschlechterunterschiede diskutiert. Aber es scheint auch Unterschiede in der ärztlichen Diagnosestellung zu geben: so wird bei gleicher Symptomatik bei Frauen häufiger eine psychische, bei Männern eine körperliche Erkrankung diagnostiziert.“
[20]
Forschungsergebnisse[21] belegen, dass Frauen* im Vergleich zu Männern* seltener Schmerzmittel verschrieben bekommen, wenn sie unter Schmerzen leiden, und stattdessen häufiger an Psycholog*innen überwiesen werden.[22]
Hier lässt sich argumentieren, dass es sich bei den festgestellten gesundheitsspezifischen Unterschieden um naturgegebene Phänomene handelt, für die niemand verantwortlich gemacht werden kann. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass viele der gesundheitlichen Probleme von Frauen* nicht unmittelbar mit ihren spezifischen biologischen Eigenschaften in Verbindung stehen. Vielmehr sind sie das Ergebnis oder die Folge anhaltender Diskriminierung oder Benachteiligung.[23]
Es kann festgestellt werden, dass die geschlechtsspezifische Medizin in der Realität nicht immer das gewünschte Maß an Inklusivität aufweist. Studien weisen darauf hin, dass ärztliches Fachpersonal männliche* Beschwerden ernster nehmen. Dagegen werden bei dem weiblichen Geschlecht anscheinend häufiger psychisch bedingte Leiden vermutet und die Behandlung dementsprechend ausgerichtet.[24]
Deutliche Geschlechterunterschiede zeigen sich auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, z.B. bei der Einnahme von Arzneimitteln. Sie betreffen zum einen die Verstoffwechselung und Wirkung von Arzneimitteln, einschließlich der Nebenwirkungen. Zum anderen gibt es Unterschiede in der Inanspruchnahme: Frauen* wenden häufiger Arzneimittel an als Männer*, sowohl mit ärztlicher Verordnung als auch in Selbstmedikation.[25]
Besonders ausführlich belegt sind Behandlungsunterschiede nach Geschlecht bei Herzinfarkten. Nach Berücksichtigung der vorhandenen Symptome und des kardialen Risikos wurden weibliche Patientinnen, die mit Brustschmerzen die Notaufnahme aufsuchten, im Vergleich zu männlichen Patienten seltener auf Herzkrankheiten getestet.[26]
Zusätzlich erfuhren Frauen* mit Brustschmerzen in der Notaufnahme längere Wartezeiten im Vergleich zu Männern*. Diese Beobachtung wurde in vier Berliner Krankenhäusern bestätigt.[27] Des Weiteren ergab eine Studie, dass kardiologische Untersuchungen bei Frauen* deutlich häufiger fehlerhaft durchgeführt wurden als bei Männern*, insbesondere wenn diese von männlichen Ärzten vorgenommen wurden.[28]
Armut und soziale Ungleichheit haben ebenso zentrale Auswirkungen auf die Gesundheit: Immer noch bekommen Frauen* im Durchschnitt 21 % weniger Gehalt als Männer*.
Diese geschlechtsspezifischen Ungleichheiten haben einen deutlichen Einfluss auf das Gesundheitswesen und stellen Barrieren dar, die zu Unterschieden in den Zugangschancen von Männern* und Frauen* führen.[29]
3.2 Erfahrungen von LGBTQ*-Menschen
Eine andere von Diskriminierung im Gesundheitswesen betroffene Gruppe sind LGBTQ*-Menschen. Trotz gesellschaftlicher Fortschritte in Richtung Akzeptanz und Gleichstellung bestehen weiterhin pathologisierende und stigmatisierende Perspektiven auf nicht-heterosexuelle und nicht-cisgeschlechtliche Lebensweisen. LGBTQ*-Menschen sind nach wie vor einem erhöhten Risiko von Vorurteilen, Stereotypen und ungleicher Behandlung durch medizinisches Fachpersonal ausgesetzt. Diese Problematik wirkt sich nicht nur auf individuelle Gesundheitsergebnisse aus, sondern beeinträchtigt auch das Vertrauen und die Bereitschaft der LGBTQ-Gemeinschaft, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen.[30]
Insgesamt berichteten acht von zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen (82%), mindestens einmal Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität an mindestens einem Ort erlebt zu haben. Bei jungen trans* und gender*diversen Menschen sind es gut neun von zehn (96%).[31]
Die Erkenntnisse der Europäischen Union Agentur für Grundrechte zeigen, dass jeder fünfte Trans*Mensch im Gesundheitswesen Diskriminierung erfährt. Der Bericht enthüllt, dass Trans*Menschen oft mit einem Mangel an Fachwissen über Transgender-Anliegen seitens der Gesundheitsdienstleister konfrontiert werden, unangemessene Fragen gestellt bekommen, ihr Geschlecht wiederholt fehlerhaft interpretiert wird, sie nicht ernst genommen oder beschimpft werden und ihnen sogar die Behandlung verweigert wird.[32]
Ein weiteres Beispiel in Hinblick auf die Verweigerung von gleichen Zugängen findet sich im Gesundheitsbereich, da der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung für Menschen mit einer HIV-Erkrankung deutlich erschwert ist. Ein konkretes Problem besteht darin, dass HIV-positive Menschen Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung in Arztpraxen haben.[33]
Zwei Studien[34] zur Gesundheit von lesbischen Frauen liefern ebenfalls klare Hinweise darauf, dass es im deutschen Gesundheitssystem Barrieren gibt.
Insgesamt hatten über 20% aller Befragten Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitssystem aufgrund ihrer lesbischen oder bisexuellen Lebensweise; ebenso viele gaben an, ihre soziosexuelle Identität aus Furcht vor Stigmatisierung und Ausgrenzung im medizinischen Bereich nicht offen gelegt zu haben: „Ich habe es nie öffentlich gemacht, um nicht schlechter behandelt zu werden.“[35]
Oftmals wurden Frauen* fälschlicherweise als heterosexuell gelesen, sogar nachdem sie ihr Coming-out hatten, bis sie aktiv diese Annahme korrigierten. Die betroffenen Frauen* kritisierten die Verwendung nicht-einschließender Fragen, die ein „Zwang zum Selbst-Outing“ darstellten. Solche Fragen bezogen sich zum Beispiel auf Verhütung oder den letzten Geschlechtsverkehr, wobei nur heterosexueller Geschlechtsverkehr angenommen wurde.
Wenn sich Frauen nicht offenbarten, führte dies vor allem in der gynäkologischen Versorgung zu Verwirrung auf Seiten der ÄrztInnen und sogar zu fehlerhaften Differentialdiagnosen und Therapieempfehlungen.[36]
Aus den Erkenntnissen über die gesundheitliche Situation von LGBTQ*-Menschen wird ersichtlich, dass sozialer Ausschluss und Diskriminierung den gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung behindern. Um das Ziel des universellen Zugangs zu erreichen, ist es unerlässlich, angemessene Ressourcen bereitzustellen, um diese Barrieren zu überwinden.
Fazit
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Gesundheitsbranche und die Forschungsgemeinschaft weiterhin in die geschlechtsspezifische Medizin investieren und sie als integralen Bestandteil der Gesundheitsversorgung etablieren. Durch eine verstärkte Sensibilisierung, Bildung und Zusammenarbeit kann sichergestellt werden, dass geschlechtsspezifische Unterschiede angemessen berücksichtigt werden und alle Patienten von den Vorteilen einer personalisierten und geschlechtsgerechten Medizin profitieren.
Letztendlich bietet die geschlechtsspezifische Medizin eine vielversprechende Perspektive für eine inklusivere, gerechtere und effektivere Gesundheitsversorgung. Es besteht daher ein dringender Bedarf an Maßnahmen, um diese Herausforderungen anzugehen und die Versorgung dieser spezifischen Minderheitsgruppen zu verbessern.
[1] Vgl. Schiebinger, Londa. 1993. Schöne Geister: Frauen in den Anfängen der modernen Wissenschaft. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 291; sowie vgl. Oertelt-Prigione, S., Hiltner, S. (2018). Medizin: Gendermedizin im Spannungsfeld zwischen Zukunft und Tradition. In: Kortendiek, B., Riegraf, B., Sabisch, K. (eds) Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Geschlecht und Gesellschaft, vol 65. Springer VS, Wiesbaden.
[2] Durch die Verwendung des Symbols „*“ wird betont, dass die Kategorie Geschlecht konstruiert ist. Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck sind keine fest definierten Kategorien. Sie gehen über die binären Bezeichnungen weiblich und männlich* bzw. Frau* und Mann* hinaus und umfassen eine Vielfalt von Identitäten.
[3] Mit dem Begriff sind: ethnische Minderheiten, LGBTQ+-Personen und Menschen mit Behinderungen gemeint.
[4] Vgl. Khrystenko, O. (2016). Die Manifestierung von Geschlechterstereotypen in Metaphern der deutschen Jugendsprache. Linguistik Online, 75(1). S.84-85.
[5] Vgl. Nolte, K. (2020). „Medizin und Geschlecht“ – Medizinhistorische Perspektive. Schwerpunkt: Gender & Medizin. In: Dr. med. Mabuse 247 September/Oktober 2020, S. 39.
[6] Ebenda, S. 39.
[7] Vgl. Maschewsky-Schneider U. (2002). Gender Mainstreaming im Gesundheitswesen — die Herausforderung eines Zauberwortes. In: Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis 34(3). S. 493.
[8] Vgl. Bartig et al. (2021): Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen – Wissensstand und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung. S. 32.
[9] Verweis auf Chen et al. 2008; Hoffmann und Tarzian 2001; Pierik et al. 2017; Samulowitz et al. 2018
[10] Vgl. Bartig, et al. (2021), S. 33.
[11] Vgl. Süess, M. Medizin: Wer hat Angst vor der gesunden Frau? WOZ Die Wochenzeitung. https://www.woz.ch/2236/medizin/medizin-wer-hat-angst-vor-der-gesunden-frau/!GGDTEYEPQ0RZ
[12] Vgl. K. Oldemeier, Kerstin: Sexuelle und geschlechtliche Diversität aus salutogenetischer Perspektive: Erfahrungen von jungen LSBTQ*-Menschen in Deutschland, In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 2-2017, S. 146.
[13] Vgl. Meinert, T. (2023): Geschlechtsspezifische Medizin. In: Deutscher Bundestag Nr. 09/23, S. 1.
[14] Vgl. Oertelt-Prigione, S., Hiltner, S. (2018).
[15] Mit dem Begriff Gender ist das gesellschaftlich zugewiesene und sozial konstruierte Geschlecht gemeint.
[16] Vgl. Keim-Klärner, S. (2019). Soziale Netzwerke und gesundheitliche Ungleichheiten im Kontext verschiedener Ungleichheitsdimensionen. In: Neue Ideen für mehr Gesundheit. Georg Thieme Verlag KG. S. 276.
[17] Verweis auf die Studie von Wetterer, 2004.
[18] Vgl. Bartig, et al. (2021), S. 56.; sowie Verweis auf die Studie von Pöge et al. 2020.
[19] Vgl. RKI “Gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland | 2020“, aufrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/frauenbericht/11_Zusammenfassung_Fazit.pdf?__blob=publicationFile.
[20] Ebenda, S. 377.
[21] Verweis auf Naamany et al. 2019; Samulowitz et al. 2018.
[22] Vgl. Bartig, et al. (2021), S. 33.
[23] Vgl. Riggers, M.: Gender Mainstreaming in Niedersachsen. In: Gesundheitswesen. 12. Tagung des Netzwerkes Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen am. 7. Dezember 2000 in Hannover, SS.4-5.
[24] Vgl. A. Klärner et al. (2019), S. 283.
[25] Vgl. RKI “Gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland | 2020“, S. 378.
[26] Vgl. Bartig, et al. (2021), S. 33.; sowie Verweis auf Chang et al. 2007.
[27] Verweis auf Jungehulsing et al. 2006.
[28] Vgl. Bartig, et al. (2021), S. 33.; sowie Verweis auf Chakkalakal et al. 2013.
[29] Vgl. A. Klärner et al. (2019), S. 283.
[30] Verweis auf Oldemeier (2017).
[31] Ebenda, S.56.
[32] Vgl. Karsay, D. (2017, October 10). Gesundheitliche Diskriminierung von Menschen außerhalb des binären Geschlechtersystems | Heinrich-Böll-Stiftung. Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.boell.de/de/2017/10/10/gesundheitliche-diskriminierung-von-menschen-ausserhalb-des-binaeren-geschlechtersystems.
[33] Vgl. Kalkum, Dorina; Otto, Magdalena (2017): Diskriminierungserfahrungen in Deutschland anhand der sexuellen Identität: Ergebnisse einer quantitativen Betroffenenbefragung und qualitativer Interviews. Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes. S. 88.
[34] Verweis auf Dennert 2005; Wolf 2004.
[35] Vgl. Dennert, G.; Wolf, G. Gesundheit lesbischer und bisexueller Frauen. Zugangsbarrieren im Versorgungssystem als gesundheitspolitische Herausforderung. In: Femina Politica 1 | 2009, S.50.; Zitate aus dem offenen Frageteil der Fragebogenerhebung. Sie werden hier z.T. gekürzt und in neuer Rechtschreibung wiedergegeben; Dennert 2005, 75-82.
[36] Ebenda.
Quelle: Atanasova Polinda, Geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung: Herausforderungen und Defizite, in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 22.09.2023, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=399