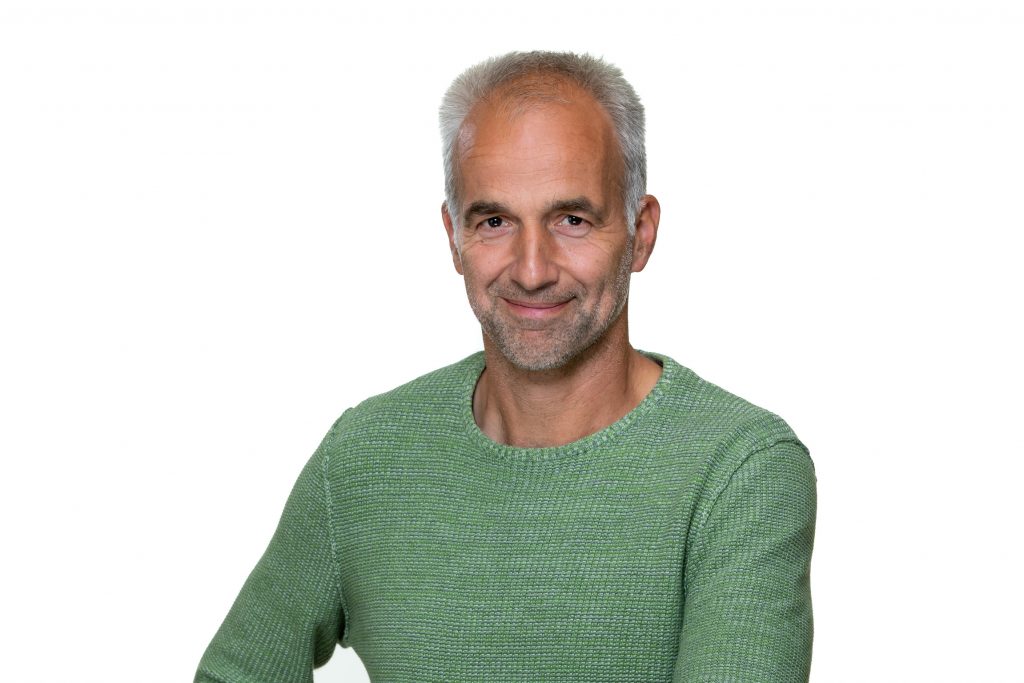Open Access und Open Science in den Koalitionsverträgen und Wahlprogrammen im Bund und in Berlin
Was steht im Ampel-Koalitionsvertrag im Bund?
Der Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ von SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP kann hier abgerufen werden. Erfreulich ist, dass Open Science als Begriff Erwähnung findet, wenn auch der Bezug zu Open Access und Open Science bis auf das Handlungsfeld Forschungsdaten insgesamt vage und bei Andeutungen (siehe insbesondere Open Science) bleibt. In Teilen bleibt der Vertrag hinter den Ausführungen des Koalitionsvertrags zur 18. Legislatur zurück (vgl. auch News von oa.network). Im Jahr 2018 wollten CDU, CSU und SPD noch eine nationale Open-Access-Strategie entwicklen, diesen Plan verfolgt die Ampelkoalition nun nicht mehr, dafür wird Open Access bereits als Standard referenziert. Dafür wird der Zugang zu Forschungsdaten erwähnt, allerdings ist es Interpretationssache, ob sich der nachfolgende Satz zur Etablierung von Open Access insoweit auf Forschungsdaten bezieht als dass Forschungsdaten standardmäßig nach den Prinzipien von Open Access zugänglich gemacht werden sollen. Interessant wird, in welcher Weise das Datennutzungsgesetz hier berücksichtigt wird, das im Sommer 2021 verabschiedet wurde. Nachfolgend eine Auflistung der relevanten Passagen aus dem Ampel-Koalitionsvertrag:
Unter II. Digitale Infrastruktur (S. 16): Unter Wahrung des
Investitionsschutzes ermöglichen wir Open Access zu fairen Bedingungen, wo nötig regulatorisch.
Unter II. Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung (ab S. 19) zu „Forschungsdaten“ (S. 21):
Das ungenutzte Potential, das in zahlreichen Forschungsdaten liegt, wollen wir effektiver für innovative Ideen nutzen. Den Zugang zu Forschungsdaten für öffentliche und private Forschung wollen wir mit einem Forschungsdatengesetz umfassend verbessern sowie vereinfachen und führen
Forschungsklauseln ein. Open Access wollen wir als gemeinsamen Standard etablieren. Wir setzen uns für ein wissenschaftsfreundlicheres Urheberrecht ein. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur wollen wir weiterentwickeln und einen Europäischen Forschungsdatenraum vorantreiben. Datenteilung von vollständig anonymisierten und nicht personenbezogenen Daten für Forschung im öffentlichen Interesse wollen wir ermöglichen.
Und ebenfalls unter II. Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung (ab S. 19) zu „Wissenschaftskommunikation und Partizipation“ (S. 24) wird Open Science erwähnt, allerdings bis auf die Handlungsfelder Wissenschaftskommunikation und Citizen Science an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Open-Source-Formate und Open Educational Resources werden dafür an anderer Stelle adressiert (siehe weiter unten).
Wissenschaft ist kein abgeschlossenes System, sondern lebt vom Austausch und der Kommunikation mit der Gesellschaft. Wir wollen Wissenschaftskommunikation systematisch auf allen wissenschaftlichen Karrierestufen und bei der Bewilligung von Fördermitteln verankern. Wir setzen uns für die Förderung des Wissenschaftsjournalismus durch eine unabhängige Stiftung, Weiterbildung für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, analoge und digitale Orte – von Forschungsmuseen bis Dashboards – ein. Wir werden mit Citizen Science und Bürgerwissenschaften Perspektiven aus der Zivilgesellschaft stärker in die Forschung einbeziehen. Open Access und Open Science wollen wir stärken.
Unter III. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft zu „Digitalisierung in der Landwirtschaft“ (S. 47):
Wir werden die von der Landwirtschaft und Ernährung benötigten öffentlichen Daten einfacher und in geeigneter Qualität und Aktualität den berechtigten Nutzern frei zur Verfügung stellen und dazu eine echte Plattform mit zentralem Zugang zu sämtlichen staatlichen Daten und Diensten einrichten, insbesondere auch für entsprechende Verwaltungsdienstleistungen. Staatliche Daten aller
Verwaltungsebenen sollen künftig in einheitlichen Formaten zur Verfügung gestellt werden. Der Agrardatenraum in Gaia-X als Basis einer europäischen Dateninfrastruktur mit klarem Nutzungsrecht für Landwirte an den betriebsspezifischen Daten, an deren Entstehung sie mitgewirkt haben, wird mit standardisierten Schnittstellen weiterentwickelt. Open-Source-Formate werden ausdrücklich unterstützt.
Unter V. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang zu „Digitalpakt Schule“ (S. 96):
Wir werden gemeinsam mit den Ländern digitale Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Ressources (OER), die Entwicklung intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftware sowie die Erstellung von Positivlisten datenschutzkonformer, digitaler Lehr- und Lernmittel unterstützen.
Zukunftshauptstadt Berlin?
Im Entwurf zur Beschlussfassung des Koalitionsvertrages „Zukunftshauptstadt Berlin. Sozial. Ökologisch. Vielfältig. Wirtschaftsstark“ zwischen SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und DIE LINKE sind die Themen Open Access und Open Science leider längst nicht so stark adressiert, wie die Wahlprogramme der drei Parteien (siehe unten ausführlich) und die jüngste Novellierung des Gesetzes zur Stärkung der Berliner Wissenschaft (BerlHG) des R2G-Senats haben hoffen lassen. Dort sind Praktiken offener Wissenschaften ausführlich in §41 „Forschungsberichte“ aufgenommen worden. Im Koalitionsvertrag findet der Begriff Open Science keine Erwähnung, auch Handlungsfelder wie Forschungsdaten, Forschungssoftware, Methoden, Open Educational Resources oder Open Peer Review werden im Wissenschaftsteil nicht aufgenommen. Dafür werden die Themen Open Source und Open Data im Zusammengang mit offenen Verwaltungsdaten und dem Aufbau von entsprechender Infrastruktur unter dem Punkt „19. Verwaltung“ (S. 124) und da im Abschnitt „Digitalisierung“ (S. 129-132) ausgeführt:
In den Verwaltungen werden Open Data Beauftragte und Chief Data Scientists benannt. Die Open Data Informationsstelle wird die Koalition weiterentwickeln und ausbauen. Ein Berliner Data Hub soll basierend auf der bestehenden Geodateninfrastruktur aufgebaut werden. Bestehende Open Data Projekte des Landes Berlin werden integriert. Die Koalition wird das Berliner Datenschutzgesetz evaluieren. Die Kontrollrechte der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit werden sichergestellt und bei ihr eine Servicestelle „Datenschutzberatung“ geschaffen. Die Koalition prüft eine Bildungseinrichtung für Datenschutz (Datenschutzakademie). In einem Pilotprojekt macht sie die Erkenntnisse aus Datenschutzfolgenabschätzungen aus allen Senatsverwaltungen öffentlich (S. 131).
Open Access wird unter Digitalisierung erwähnt, allerdings nur in Form von „Open Access Lizenzen“:
Für eine digital souveräne Stadt sind Open Source und offene Standards unverzichtbar. Die Koalition wird bei jeder Softwarebeschaffung nach Open Source Alternativen suchen und speziell für die Verwaltung erarbeitete Software unter freien Lizenzen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Auch zentrale Förderprogramme für IT-Projekte sollen diesen Ansatz verfolgen. Open Data, Open Application Programming Interface, Creative Commons Lizenzen für digitale und Open Access Lizenzen für wissenschaftliche Dokumente sollen wo möglich verwendet werden. Bei Beschaffungen werden alle Kosten über den gesamten Betriebszeitraum als Kriterium der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt, einschließlich derß Möglichkeit zur Anpassung und Erweiterung (Baukastenprinzip). Dies gilt auch für Cloud- Technologien. Die Nichtbeschaffung von Open Source muss begründet werden (S. 131).
Die Unterscheidung zwischen „Creative Commons Lizenzen“ und „Open Access Lizenzen“ bleibt etwas unklar, da CC-Lizenzen inzwischen etablierte Lizenzen für Open-Access-Textveröffentlichungen sind (und oft auch für Forschungsdaten verwendet werden). Das Augenmerk im Abschnitt „Digitalisierung“ liegt auf Open-Source-Infrastrukturen, die von der Koalition mit einem eigenen Kompetenzzentrum unterstützt werden soll:
Die Koalition richtet einen Open Source Fonds zur Finanzierung von Entwicklungs-Communities ein, die das Land Berlin braucht, um Anwendungen zu pflegen und weiterzuentwickeln. Beim ITDZ Berlin wird ein „Kompetenzzentrum Open Source“ eingerichtet, Synergiepotenziale in länderübergreifenden und internationalen IT-Kooperationen werden nutzbar gemacht (S. 131).
Im Abschnitt „17. Wissenschaft, Forschung und Hochschulen“ (S. 113-118) wird weder Open Access noch Open Science als Handlungsfeld benannt. Im vorherigen Koalitionsvertrag „Berlin gemeinsam gestalten. Solidarisch. Nachhaltig. Weltoffen.“ 2016-2021 haben SPD, DIE LINKE und Bündnis 90/ Die Grünen explizit auf Open Access im Abschnitt „Digitale Wissenschaft ist offene Wissenschaft“ (S. 90) verwiesen und ihre Unterstützung für die Umsetzung der Open-Access-Strategie für Berlin zugesagt:
Die Koalition wird die Open-Access-Strategie umsetzen und ein Zukunftsprogramm Digitalisierung der Wissenschaft auflegen. Dabei sollen Open-Access-Publikationen, aber auch digitale Lehr- und Lernformate sowie offene Forschungsdaten etwa durch Regelungen in den Hochschulverträgen unterstützt werden.
Der jetzige Koalitionsvertrag spiegelt leider nicht den Stand der Umsetzung von Open Access und Open Science in der „Zukunftshauptstadt Berlin“ wieder und auch nicht die Planungen für eine Landesinitiative Open Research Berlin (siehe „Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin“). Das hat uns sehr verwundert, denn auch die Wahlprogramme waren deutlich progressiver.
Die Wahlprogramme im Rückblick
Open Access und Open Science in den Wahlprogrammen 2021 (Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und Bundestagswahl)
Der nachfolgende Teil ist übernommen aus den News des Open-Access-Büros Berlin vom 2. August 2021.
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus statt. Das OABB hat sich die Wahlprogramme der Parteien in Bezug auf die Themen Open Access und Open Science angesehen und außerdem Wahlprüfsteine zu diesen Themen in Zusammenarbeit mit u.a. dem Landesverband Berlin des dbv vorbereitet. Die Fragen konzentrierten sich auf die Punkte der Finanzierungstrukturen und Unterstützung der Einrichtungen bei der OA-Transformation, Anerkennung von Open-Science-Praktiken, Forschungsdaten in künstlerischen Disziplinen, Landesmaßnahmen zum Forschungsdatenmanagement und die Diskussion von Werten einer offenen Wissenschaft. Die Wahlprüfsteine wurden am 27. Juli 2021 veröffentlicht und werden nachfolgend mit ausgewertet. Dabei erfolgt eine Konzentration auf die Aussagen, die dezidiert zu Open Access und Open Science gemacht werden. Die Wahlprüfsteine sind darüber hinaus auch in Bezug auf die Rolle und Weiterentwicklung der (Berliner) Bibliotheken sehr lesenswert.
Die Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die CDU benennen Open Access bzw. Open Science als Handlungsfelder in ihren Wahlprogrammen und gehen auch in den Antworten zu den Wahlprüfsteinen ausführlich auf diese Themen ein. Die FDP äußert sich in ihrem Wahlprogramm nicht zu den Themen, aber formuliert eine ausführliche Antwort zu den Wahlprüfsteinen.
SPD
Die SPD bezieht sich in ihrem Wahlprogramm „Ganz sicher Berlin“ auf den Begriff Open Science, „also den freien Zugang zu Wissen und Überprüfbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse„. Open Science wird als Bestandteil „moderner Wissenschaftkomunikation“ verstanden und damit als förderwürdig befunden. Deutlich ausführlicher bezieht die SPD in der Antwort zu den Wahlprüfsteinen Position. Sie betrachtet Open Science und Citizen Science als komplementäre, anzustrebende Ansätze einer offenen Wissenschaftskultur. Sie formuliert für die eigene Wissenschaftspolitik das Ziel bzw. den Anspruch,
„allen Bürger:innen den Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermöglichen, unabhängig von Herkunft, Bildung, sozialer Lage und finanziellen Mitteln. Unsere Vision einer offenen Wissenschaftskultur für Berlin zeichnet sich durch Transparenz, Durchlässigkeit und die Fähigkeit aus, Wissen in die Stadtgesellschaft zu transferieren und neue Forschungsansätze außerhalb der wissenschaftlichen Community aufzugreifen. Vor diesem Hintergrund treten wir in unserem Wahlprogramm für die Prinzipien von Open Science und Citizen Science ein, die unseres Erachtens nach Hand in Hand gehen und nur mit einer Open-Access-Transformation, eingebettet in eine Digitalisierungsoffensive für die Berliner Wissenschaftsstruktur, erreicht werden können.„
Die umfängliche Digitalisierungsoffensive im Rahmen der laufenden Hochschulverträge, die Digitalisierungsförderung sowie das Sofortprogramm „VirtualCampusBerlin“ schaffen allesamt den Rahmen für eine Open-Access-Transformation. Weiterhin bezieht sich die SPD auf die OA-Strategie von 2015 und das OA-Büro:
„Perspektivisch wollen wir das Open-Access-Büro zu einem Open-Science-Büro weiterentwickeln. Berlin bleibt damit auf diesem Gebiet bundesweit Vorreiter. Die Berliner SPD will auf diesem Erfolg aufbauen und diese Strukturen weiterhin stärken. Wir werden daher prüfen, inwieweit diese Maßnahmen gebündelt in den Mitteln der Qualitätsoffensive verankert werden können. Ein weiterer zentraler Baustein der Open-Access-Strategie ist für uns die hochschulübergreifende Vernetzung. Hier setzt die Berlin University Alliance einen beispielgebenden Rahmen, um die verschiedenen Strategien der Hochschulen aufeinander abzustimmen und Synergien zu schaffen. Um die Strategiefähigkeit der Hochschulen in diesem Bereich zu stärken, sind neben finanziellen und strukturellen Aspekten die personelle Ausstattung und die Sicherstellung eines gut ausgebildeten IT-Personals unabdingbar.„
Darüber hinaus setzt die SPD auf entsprechende Anerkennungsysteme für Open Science:
„Derzeit konzentrieren sich die Kriterien wissenschaftlicher Evaluationen auf innerwissenschaftliche Kriterien wie beispielsweise monodisziplinäre Zitierketten. Aufgabe der Politik als wichtiger Fördergeber ist es dabei, das Prinzip der Open Science stärker als Qualitätskriterium für zu fördernde wissenschaftliche Projekte zu etablieren und bei der Vergabe öffentlicher Forschungsaufträge zu berücksichtigen.„
Auf die Frage zu den landesspezifischen Maßnahmen in Bezug auf Open-Access-Veröffentlichungen und Forschungsdaten gibt die SPD eine Antwort, die sich schwerpunktmäßig auf (digitale) Kulturvermittlung und die Schaffung einer adäquaten Infrastruktur für die Digitalisierung im Kulturbereich und Digitalisierung in der Verwaltung fokussiert. Zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie soll u.a. „ein Kompetenzzentrum für Open Source beim landeseigenen IT-Dienstleister ITDZ [eingerichtet werden], um die Weiterentwicklung freier Software zu unterstützen.“
Darüber hinaus sieht die SPD in der „Dichte und Vielfalt an Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen“ ein
„[…] unglaubliches Potenzial, das wir in den kommenden zehn Jahren gezielt weiter auszubauen werden. Dies wird nur gelingen, wenn wir weiterhin für eine offene, kritische und unabhängige Wissenschaft sorgen, die sich (stadt-)gesellschaftlichen Veränderungen und Debatten stellt. So sind Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen öffentliche Institutionen, die in einem Spannungsverhältnis zwischen Autonomie von Wissenschaft und Forschung einerseits und den gesellschaftlichen Bedarfen und gesellschaftlicher Verantwortung andererseits stehen. Sozialdemokratische Wissenschafts- und Forschungspolitik greift entsprechend gestaltend ein, ohne die Autonomie von Wissenschaft und Forschung einzuschränken. Um alle Berliner:innen in diesen Aushandlungsprozess wissenschaftlicher Werte einzubeziehen, braucht es eine solide und zugängliche Wissenschaftskommunikation. Nicht nur intern, sondern vor allem mit allen Teilen der Gesellschaft. Dazu gehört es, Wege zu finden, um Wissenschaft zugänglich und nahbar zu machen, etwa durch freie Eintritte für Museen und Dialogformate zum Austausch zwischen Wissenschaftsinstitutionen und Stadtgesellschaft. Wissenschaft muss als Citizen Science auch in Zusammenarbeit mit den Bürger:innen der Stadt Raum finden, wie dies am neuen Wissenschaftscampus für Natur und Gesellschaft stattfindet. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen müssen Orte der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung bleiben. Für die Kommunikation mit der Stadtgesellschaft und die Debatte über gegenwärtige und zukünftige Fragestellungen braucht die Wissenschaft nicht nur Schaufenster, sondern Räume in allen Teilen der Stadt. Diese gilt es zu identifizieren, für das Land und die Wissenschaft zu sichern und tragfähige Konzepte mit den Partner:innen zu entwickeln. Wissenschaft muss Akzeptanz schaffen und wissenschaftliche Ergebnisse aller Disziplinen sollen Eingang finden sowohl in politisches, wirtschaftliches und Alltagshandeln. Inter- und transdisziplinäre Forschungsverbünde müssen gefördert werden und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie Fragestellungen beispielsweise durch die Etablierung von Black Studies, Bioethik und Stärkung pluraler Ökonomik sowie Künstlicher Intelligenz oder Wasserstofftechnologie. Wissenschaft muss begeistern, um Nachwuchs zu finden, nicht nur für akademische Berufe, sondern auch für wissenschaftsunterstützende Berufe wie z.B. Laborassistenz u.v.a. Für diese Prozesse werden sowohl Räume benötigt sowie Strukturen, die diese Kommunikation organisieren. Schüler:innenlabore, Schüler:innenuni sind Angebote, die junge Menschen für verschiedenste Disziplinen begeistern sollen. Dies ist besonders für die jungen Menschen wichtig, die diese Zugänge nicht über das Elternhaus vermittelt bekommen können„.
Bündnis 90/Die Grüne
Bündnis 90/Die Grüne verknüpft in ihrem Wahlprogramm „Grünes Licht für Morgen“ mit einer Praxis der offenen Wissenschaft auch das Versprechen, diese zu belohnen: „Forschungsprojekte, die ihre Ansätze und Daten transparent anderen Wissenschaftler*innen und der Gesellschaft zur Verfügung stellen, sollen sich […] positiv auf die Finanzierung der Hochschulen auswirken und landesseitig durch die erforderliche Infrastruktur sowie beratendes und technisches Fachpersonal abgesichert werden„. Der Bezugsrahmen für die Grünen ist dabei eine Open-Science-Strategie. Auch in der Antwort zu den Wahlprüfsteinen bezieht die Partei Stellung (vgl. S. 4f.):
„Wir betrachten Open Access/Open Science als grundlegendes Prinzip wissenschaftlicher Arbeit und wollen den notwendigen Kulturwandel in der Wissenschaftslandschaft mit einer besseren Grundfinanzierung der Hochschulen in Verbindung mit konkreten Vorgaben im Berliner Hochschulgesetz umfassend unterstützen. Darüber hinaus wollen wir insbesondere die Bibliothekssysteme im Rahmen der Hochschulverträge für Aufgaben im Bereich Open Access/Open Science gezielt stärken, beispielsweise zur Finanzierung von Open Access-Veröffentlichungen oder zum Betrieb von Repositorien. Das Open-Access-Büro des Landes möchten wir weiterentwickeln und auch in Zukunft finanziell absichern. Open Science-Praktiken müssen seitens der öffentlichen Institutionen mindestens genau so [sic] stark honoriert werden wie andere wissenschaftliche Resultate. Wo die Wissenschaftspolitik entsprechende Anreize setzen kann – etwa bei Berufungsverfahren oder der Vergabe von Mitteln – werden wir dies auch tun. Wir wollen alle Fachkulturen im Bereich Open Access zu größerer Offenheit anregen und begrüßen alle Maßnahmen, verbliebene Hürden abbauen. Dabei setzen wir auf einen engen Austausch zwischen Wissenschafts-, Kultur-, Medien- und Netzpolitik sowie den jeweiligen Stakeholdern, und werben dafür auch im Rahmen der wissenschaftspolitischen Vernetzung mit dem Bund und anderen Bundesländern. Deshalb begrüßen wir auch den Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) auf Grundlage der Bund-Länder Vereinbarung von 2018. Wenn Landesinstitutionen im Zuge dessen zusätzliche Bedarfe identifizieren, werden wir uns einer Finanzierung nicht versperren. Als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßen wir alle Diskussionen über die Werte offener Wissenschaft und freuen uns, wann immer diese in geeigneter Form stattfinden. Das gilt für die weitere Debatte im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses, aber auch mit Blick auf das geplante Forum zur Aufnahme wissenschaftlicher Ideen aus der Stadtgesellschaft. Besonders gut fänden wir es, wenn Open Science in allen wissenschaftlichen Fach-Communities breit diskutiert und perspektivisch zum allgemein akzeptierten Standard würde. Wir danken allen Wissenschaftler*innen die sich hierfür – oftmals mit hohem Zeitaufwand und entgegen tradierter Fachkulturen – engagieren.“
Die Linke
Die Linke bezieht sich in ihrem Wahlprogramm „rot. radikal. realistisch. – Unser Programm für die soziale Stadt“ ebenso auf den Begriff Open Science und betont: „Wir wollen eine umfassende Open-Science-Initiative für Berlin. Konzeptionen, die etwa aus dem Open Acess Büro Berlin vorliegen, wollen wir in die Umsetzung bringen.“ In ihrer Antwort zu den Wahlprüfsteinen (vgl. S. 3f.) bezeichnet Die Linke Open Access als Grundgedanken der Wissenschaft und spricht sich für die Weiterentwicklung der Open-Access-Strategie von 2015 aus. Sie bezieht sich u.a. darauf, dass die „finanziellen Mittel für die Hochschulen auch in den Hochschulverträgen ab 2023“ durch den aktuellen rot-rot-grünen Senat fortgeschrieben werden sollen, während andere Bundesländer hier Kürzungen vorsehen. Sie steht außerdem der Einrichtung eines zentralen Publikationsfonds positiv gegenüber und geht damit neben der SPD auf diesen Punkt der Finanzierung konkret ein. Anerkennungsmechanismen für Open Science sollen laut Die Linke durch die Wissenschaftscommunity selbst entwickelt werden, die
„Politik kann solche Entwicklungen jedoch anstoßen und fördern, indem das Publizieren im Open-Access-Verfahren durch die Hilfestellung beim Einrichten weiter vereinfacht und durch öffentliche Mittel, wie z.B. einen Publikationsfonds, unterstützt wird. Forschungsleistungen und Evaluationen müssen in Zukunft verstärkt auch Open-Access-Veröffentlichungen und die Teilnahme an Peer-Review-Verfahren mit einbeziehen.“ Hinsichtlich der Forschungsdaten in künstlerischen Wissenschaften betont Die Linke die Vielfalt der Formate und Inhalte und sieht für die Politik eine Rolle als „Impulsgeberin„, „die Künsterlinnen und Künstler und Institutionen dabei unterstützt, Lösungen zu finden. Das kann bspw. durch die finanzielle Unterstützung von Workshops und Konferenzen wie auch eine personelle Aufstockung des Berliner Open-Access-Büros geschehen, so dass verstärkt für die spezifischen künstlerischen Bedürfnisse eine Open-Access-Möglichkeit entwickelt werden kann.“ Die Linke unterstützt auch auf Bundesebene „Initiativen für ein wissenschaftliches Urheberrecht, das explizit auch künstlerische Werke für Bildung und Wissenschaft zugänglich macht.“
Hinsichtlich einer Landesstrategie für das Management, die Langzeitarchivierung und OA-Veröffentlichung von Forschungsdaten befürwortet Die Linke den
„Aufbau einer zentralen Infrastruktur, die das Angebot der dezentralen Repositorien an den Hochschulen ergänzt, erweitert und den Zugang auf die Forschungsdaten berlinweit, national wie auch international ermöglicht und auf Dauer sichert.“ Hochschulen, Bibliotheken und Kultureinrichtungen sollen dazu „in die Lage versetzt werden, an diesem Prozess gestaltend mitzuwirken.“ Auf die Frage zur Diskussion der Werte offener Wissenschaft antwortet Die Linke abschließend: „Open Science funktioniert für uns nur zusammenfassend, wenn ihr bestimmte Werte, wie z.B. Diversität, Gleichheit, Nachhaltigkeit und Inklusion zugrunde liegen. Um dieses Ziel zu fördern, plant die rot-rot-grüne Koalition noch in diesem Jahr, im Rahmen einer Hochschulgesetzesnovelle Diversitätsbeauftragte oder -gremien an allen Hochschulen verpflichtend zu etablieren und das Publizieren im Open-Access-Verfahren zum Standard wissenschaftlicher Praxis zu machen. Gemeinsam mit dem Open-Access-Büro und über die Hochschulverträge soll so Verständnis und Akzeptanz bei den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren geschaffen werden. Wir stehen für eine Demokratisierung der Hochschulen, denn vor allem durch sie kann Diversität, Nachhaltigkeit, Gleichheit und Inklusion in der Wissenschaft gefördert werden.“
FDP
Die FDP bespricht die Themen Open Access und Open Science in ihrem Wahlprogramm nicht. Sie geht aber in ihrer Antwort zu den Wahlprüfsteinen (vgl. S. 3ff.) ebenso ausführlich wie die anderen Parteien auf die Fragen zu Open Access und Open Science ein. Sie setzt sich
„[w]ann immer es möglich und zweckmäßig ist, setzen sich die Freien Demokraten deshalb für eine „Open Access“-Politik ein. Damit auch die Allgemeinheit von den Ergebnissen der Forschung profitieren kann, setzen wir uns für eine Open-Access-Politik ein: Ergebnisse und Publikationen, die wesentlich mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, sollen unter Berücksichtigung eines Erstverwertungsrechts auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein„.
Auf die Frage nach Anerkennungsmechanismen für Open Science formuliert die FDP:
„Die Open-Access-Strategie für Berlin hat dazu Handlungsempfehlungen formuliert, die wir Freie Demokraten für praxistauglich halten. Wir sehen bei der Umsetzung die Expertise der Fachleute als politische Vorgaben gefordert und sind für die Diskussion möglicher Vorhaben und weiterer nötiger Schritte offen. Die Bemühungen um Open Access sind ein erster Schritt zu Open Science. Hierfür hat die Anhörung vom 6. März 2017 im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses wichtigen Input geliefert, die in weitere Schritte münden sollten. Hierzu wäre der Austausch mit den Kompetenzträgern fruchtbar zu machen, damit das klare politische Ja zu Open Access und Open Science durch die Akteure im Wissenschaftsbetrieb und der Verwaltung praktisch umgesetzt wird.„
Auf die Frage nach der Spezifik für künstlerische Forschungsdaten verweist die FDP auf den fairen Interessenausgleich zwischen geistigem Eigentum und dem allgemeinen Interesse am freien Zugang:
„Das geltende Urheberrecht hinkt der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung hinterher und bremst Innovationen aus. Wir Freie Demokraten wollen das Urheberrecht nach dem Vorbild des amerikanischen „Fair Use“-Prinzips maßvoll weiterentwickeln und hierzu die bisherigen Schranken des Urheberrechts durch eine 57 Bagatellklausel für private Nutzungen, die keine wirtschaftlichen Folgen haben und – keine kommerziellen Interessen verfolgen. Hier ist der Gesetzgeber auf Bundesebene gefordert und insbesondere eine Verständigung der Wissenschaft mit den großen Verlagen erforderlich. Das Verhältnis zwischen Kunstfreiheit und dem Schutz geistigen Eigentums muss im digitalen Zeitalter neu gedacht werden und gleichzeitig die Urheberin sowie den Urheber eines Werkes in ihren oder seinen wirtschaftlichen und ideellen Rechten schützen. Dies ist Grundvoraussetzung für eine lebendige Kultur- und Kreativwirtschaft. Hier ist insbesondere die Bundespolitik gefordert.“
Zum Thema Forschungsdaten verweist die FDP auf die Open-Access-Strategie von 2015,
„[…] die gewiss noch nicht in allen Teilen praxiswirksam geworden ist. Bei der Fortentwicklung der Strategie halten wir es für ratsam, die einschlägige Expertise der Berliner Wissenschafts- und Bildungslandschaft durch geeignete Partizipationsprozesse in ergebnisoffenen Diskussionen fruchtbar zu machen. Die politischen Parteien sind dabei gut beraten, sich über die Formulierung des politischen Anliegens hinaus politischer Vorgaben zur Ausführung im Detail zu enthalten, also das Ergebnis gewissermaßen schon vorweg nehmen zu wollen.“ Im Bezug auf die Werte offener Wissenschaft bezieht sich die FDP in ihrer Antwort auf das Diversity Management: „Die Bedeutung des Diversity Managements für die Arbeitsatmosphäre und die Betriebsergebnisse wird in der Wirtschaft zunehmend anerkannt. Wir Freie Demokraten wollen in der Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity Management (Management der Vielfalt) als Teil der ökonomischen und auch gesellschaftlichen Modernisierung. So schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung – unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität oder Religion. Die öffentliche Hand, ihre Verwaltung und Institutionen, aber auch staatlich geförderte Einrichtungen haben hier eine Vorbildfunktion. Bildung und Kultur kommt dabei eine besondere Schlüsselrolle bei der Vermittlung der Vorteile und Beseitigung von Vorurteilen gegenüber der Vielfalt, Veränderung und vorübergehend fremden Ideen als Voraussetzungen jeder Innovation zu.„
CDU
Die CDU fomuliert ihre Ziele zu Open Access bzw. Open Science in ihrem Wahlprogramm „Berlin-Plan“ unter der Überschrift „Rechtssicherer Ausbau digitaler Angebote“ (vgl. S. 122): „Open-Access-Publikationen, aber auch digitale Lehr- und Lernformate sowie offene Forschungsdaten müssen etwa durch Regelungen in den Hochschulverträgen unterstützt werden. Wir werden uns auf Bundes- und europäischer Ebene für ein wissenschaftsfreundliches Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrecht und einen rechtlich gesicherten Ausbau der Open Access- und Open Data-Angebote einsetzen.“ In der Antwort zu den Wahlprüfsteinen (vgl. S. 4f.) verweist die CDU u.a. ebenfalls auf die Anpassung der Hochschulverträge bzw. des Berliner Hochschulgesetzes:
„Die CDU Berlin setzt sich seit vielen Jahren für eine nachhaltige Etablierung von Open Access als Standard des wissenschaftlichen Publizierens in der Wissenschaft ein. Mit der Verabschiedung der Berliner Open-Access-Strategie haben wir auf Landesebene hierfür die notwendige Grundlage geschaffen. Wir halten es für erforderlich, die Maßnahmen durch entsprechende Förderaktivitäten zu ergänzen. Neben einem Anreizsystem für öffentliches Publizieren bedarf es verlässlicher und dauerhafter Strukturen zur Finanzierung von Open-Access-Publikationen. Zusätzliches Potenzial sehen wir in einer stärkeren Vernetzung der Akteure. Um Kompetenzen auf Landesebene zu bündeln, sollte neben dem bestehenden Open-Access-Büro eine Koordinierungs- und Vernetzungsstelle aufgebaut werden, die Vertreter der wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenführt. Open Access darf nicht an Landesgrenzen stehen bleiben. Eine Vernetzung der Länder ist unerlässlich. Die Berliner Hochschulen haben im Bereich Open Access bereits vielfältige Aktivitäten unternommen. Wir unterstützen dieses hochschulische Engagement, setzen uns darüber hinaus jedoch für mehr Verbindlichkeit und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ein. Ersteres sollte durch eine stärkere Verankerung von Open Access im Berliner Hochschulgesetz und in den Hochschulverträgen erfolgen. Angesichts der fortschreitenden technischen Entwicklung muss Wissenschaftlern der Zugang zu Forschungsdaten erleichtert werden, damit aus dem Wissens- und Technologietransfer auch Innovationen von gesamtgesellschaftlichem Nutzen resultieren können. Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung sollten daher allgemein zugänglich sein, sofern dies dem Technologietransfer nicht entgegensteht.„
Fazit
Das Land Berlin unterstützt Open Access an den Berliner wissenschaftlichen Landeseinrichtungen im Rahmen der Open-Access-Strategie Berlin bereits seit dem Jahr 2015. Das Open-Access-Büro hat im Auftrag von und in Abstimmung mit der AG Open-Access-Strategie für Berlin unter Leitung des ehemaligen Staatssekretärs für Wissenschaft und Forschung Steffen Krach und des Direktors der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin Andreas Brandtner eine Initiative für mehr offene Wissenschaft in Berlin vorgelegt, die leider noch nicht veröffentlicht werden konnte. In dem Papier „Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin“ streben die Berliner wissenschaftlichen Landeseinrichtungen gemeinsam an, die Förderung von Offenheit und Transparenz in Bezug auf den gesamten Forschungsprozesses im Sinne einer offenen Wissenschaft (Open Science bzw. Open Research) umzusetzen. Auf die Punkte der Empfehlungen wird in den Wahlprogrammen erfreulicherweise teils sehr ausführlich Bezug genommen und auch die Zusammenarbeit mit dem Open-Access-Büro wird als Ziel formuliert. Es besteht aber darüber hinaus der Bedarf, gemeinsam mit politischen Akteur*innen die Lücke zwischen Diskussions- und Umsetzungsständen an den Berliner Einrichtungen und den politischen Planungen zu schließen, die Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen sowie einen partizipativen Prozess für die Stärkung einer offenen Wissenschaft in Berlin anzustoßen. Leider sind diese Forderungen der Koalitionsparteien SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und DIE LINKE nicht in den Koalitionsvertrag 2021-2026 eingegangen. Im Nachgang zur Veröffentlichung des Berliner Koalitionsvertrags gab es dahingehend aber noch einen ermutigenden Austausch mit Vertreter*innen des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung. Daher sind wir guter Dinge, dass eine Initiative für offene Wissenschaft in Berlin weiterhin auf der Agenda steht.
Die Berliner Linke stimmt allerdings erst am 17. Dezember über den Koalitionsvertrag ab. Spannend bleibt es für Berlin ohnehin, denn sehr bald müssen die neuen Hochschulverträge zwischen dem Land und den Hochschulen ausgehandelt werden. Open Science ist im neuen Berliner Hochschulgesetz nicht nur erstmalig erwähnt, sondern unter § 41 Abschnitt 5 wird „die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft (Open Science) bei der Bewertung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren“ von den Hochschulen gefordert. Ob Berlin eine Zukunftshauptstadt für offene Wissenschaft ist, wird sich daran zeigen, wie die Zielvorgaben des Hochschulgesetzes in den kommenden Jahren tatsächlich umgesetzt werden. Wir blicken vorsichtig optimistisch auf das Jahr 2022 und freuen uns darauf einen partizpativen Prozess mit den vielen Berliner Akteur*innen insbesondere in Wissenschaft und Kultur anzustoßen.