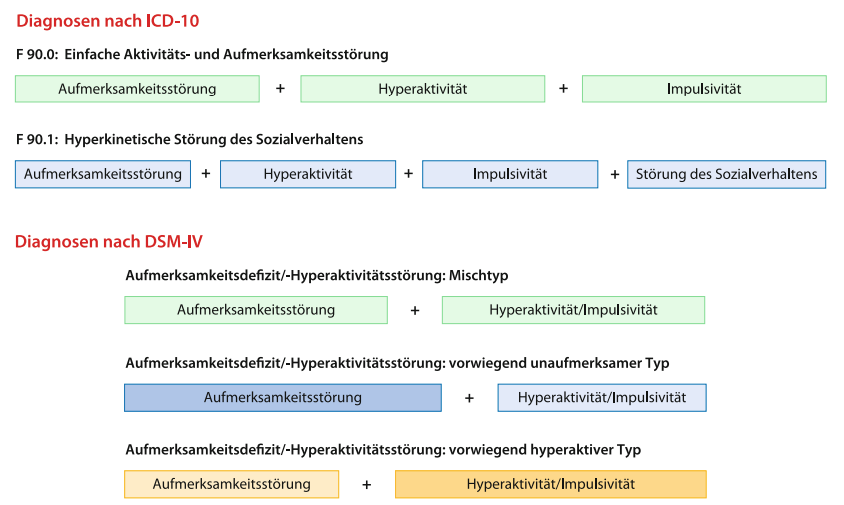Lea Nitsch (WiSe 2024/25)
Einleitung
Jeden Tag menstruieren mehr als 300 Millionen Menschen weltweit (1) und obwohl etwa die Hälfte der Weltbevölkerung diesen biologischen Prozess erlebt, werden damit regelmäßig Scham, Stigmatisierung und Tabus verknüpft. Diese negative Wahrnehmung, die in der Gesellschaft vorherrschend ist, wird als „period shaming“ oder „menstrual shaming“ beschrieben. Übersetzt bedeutet dies „Perioden-Beschämung“ oder „Menstruations-Beschämung“.
„period shaming“ sowie „menstrual shaming“ manifestiert sich in verschiedenen Formen, von Schweigen und kulturellen Tabus bis hin zu offener Diskriminierung, unzureichender Aufklärung und mangelndem Zugang zu Gesundheitsdiensten. Die Auswirkungen sind tiefgreifend und können nicht zuletzt zu gesundheitlichen Komplikationen führen. Menstruierende Menschen sehen sich zum Beispiel gezwungen ihre Periode zu verstecken oder Fakten über ihre Menstruation zu verschleiern, womit negative Auswirkungen auf das körperliche, emotionale und soziale Wohlbefinden verknüpft sind (2).
In dem Diskurs über Menstruation spielt der Aspekt Gender eine wichtige Rolle, da Menstruation traditionell als ein biologisches Merkmal von Frauen wahrgenommen wurde und größtenteils auch weiterhin so wahrgenommen wird. Die Konsequenz ist eine vermeintliche Verknüpfung zwischen dem Konzept von Menstruation und Weiblichkeit (3). Gesellschaftlich wird die Menstruation weitgehend als „weibliches Thema“ angesehen, was oft zur Tabuisierung führt. Allerdings greift diese Perspektive zu kurz, da nicht alle Frauen menstruieren, beispielsweise aufgrund von diversen medizinischen oder hormonellen Faktoren und nicht alle Menschen, die menstruieren, sich als Frauen identifizieren. Menstruierende Menschen können ebenfalls zum Beispiel trans* Männer, nicht-binäre oder genderqueere Personen sein. Das Stigma rund um die Menstruation spiegelt und verstärkt bestehende patriarchale Strukturen, indem es menstruierende Menschen als „unrein“ oder „schwach“ darstellt. Solche Einstellungen tragen zur systematischen Benachteiligung von Frauen und anderen menstruierenden Menschen bei (4).
Die Verknüpfung von Menstruation und Gender zeigt, wie eng biologische Prozesse mit sozialen und kulturellen Strukturen verflochten sind und wie wichtig es ist, diese Verbindungen kritisch zu hinterfragen, um mehr Gleichberechtigung und Inklusion zu schaffen. Besonders deutlich zeigt sich die Verbindung von Menstruation und Gender ebenfalls in der Art und Weise, wie menstruierende Menschen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen Ressourcen erhalten oder daran gehindert werden.
Diese Hausarbeit soll die Verbindung von Geschlechterrollen, Menstruation und Gesundheit genauer beleuchten. Eine geschichtliche Einordnung der Wahrnehmung der Menstruation soll zunächst ein Verständnis für das Spannungsfeld heute geben. Dieses soll daraufhin erörtert werden, indem auf Mythen und das Stigma über Menstruation eingegangen wird. Weiterhin wird Repräsentationsmangel von trans* und non-binären Menschen, die menstruieren eingeordnet. Folglich soll der Einfluss auf die Gesundheit aufgezeigt werden und ein Ausblick auf mögliche Veränderungen dieser gegeben werden. Des Weiteren wird eine persönliche Selbstreflexion zum Thema der Hausarbeit vorgenommen.
Geschichtliche Einordnung
Ein Blick auf die geschichtliche Wahrnehmung der Menstruation zeigt schnell auf, wo sich der Ursprung heutiger Vorurteile befindet. Im alten Ägypten wurde Menstruationsblut in medizinischen Rezepturen verwendet, während bei indigenen Völkern Nordamerikas menstruierende Menschen als spirituell stark galten. In den griechisch-römischen Kulturen fanden jedoch bereits negative Zuschreibungen statt. Aristoteles sah Menstruationsblut als „unreines“ Nebenprodukt des Körpers. In den patriarchalen Weltreligionen wurde dieser Unreinheitsgedanke als Legitimation weiter ausgeführt und stellt die Grundlage dar, um Frauen systematisch zu unterdrücken und auszuschließen, besonders während ihrer Periode (5).
In Europa verstärkte sich im Mittelalter die Pathologisierung der Menstruation, wobei menstruierende Menschen als „krankhaft“ oder gefährlich während dieser galten. Erst mit der Aufklärung begann eine wissenschaftlichere Betrachtung, wobei die Medizin die Menstruation jedoch weiterhin problematisierte und sie in Zusammenhang mit Schwäche gebracht wurde. Im 20. Jahrhundert brachte die industrielle Produktion von Hygieneartikeln (z. B. die Einführung von Tampons in den 1930er-Jahren) eine praktische Erleichterung und eine erste Welle des öffentlichen Diskurses (6). Feministische Bewegungen ab den 1960er-Jahren kämpften für eine Enttabuisierung und körperliche Selbstbestimmung. Dieser Prozess dauert immer noch an.
Mythen über die Menstruation
Die Vorurteile und Mythen, die dazu führen, dass die Menstruation weitestgehend pathologisiert wird und schambehaftet ist, sind vielfältig. Einige Mythen scheinen jedoch besonders herauszustechen, wodurch ihre Entkräftung umso wichtiger ist. Oftmals sind die Übergänge zwischen einzelnen Mythen nicht klar abgrenzbar. Im folgenden Abschnitt werden einige Mythen aufgegriffen, ohne jedoch einem Anspruch an Vollständigkeit zu genügen, da es unzählige Mythen über die Menstruation gibt.
Eines der verbreitetsten Mythen ist jenes der „irrationalen Frau“, welches davon ausgeht, dass (hier ausschließlich und derogativ gemeint) Frauen aufgrund ihrer biologischen Grundvoraussetzung emotionaler sind und folglich eine geringere Kontrolle über ihr selbst haben und weniger Vernunft besitzen (7). Der mögliche Kontrollverlust, der hiermit beschrieben wird, ist Grundlage dafür Frauen z.B. als keine verlässlichen Personen für Führungspositionen einzustufen.
Ein medizinscher Faktor, der dieses Bild weiterhin prägt ist die Diagnose des prämenstruellen Syndroms (PMS) (8). Sally Kingbeschreibt in ihrem Artikel “Premenstrual Syndrome (PMS) and the Myth of the Irrational Female“ (7), dass die Zuschreibung psychologischer Symptome der Menstruation und medizinische Klassifizierung dieser weit über die Beschreibung der eigentlichen physischen Symptome hinaus geht. Sie zeigt auf, dass die Darstellung der Menstruation und ihre Pathologisierung auf einer sexistischen historischen Blickweise auf die Menstruation basiert. King weist darauf hin, dass nur eine Minderheit der menstruierenden Personen schwere zyklische Symptome erlebt, die medizinische Unterstützung erfordern. Das explizite Anerkennen und Entkräften des Mythos der „irrationalen Frau“ und seines Einflusses auf die klinische Beschreibung und Behandlung von PMS ist laut King ein wichtiger Schritt, um diejenigen besser zu unterstützen, die tatsächlich zyklische Symptome erleben (7). Dabei soll vermieden werden, ungewollt oder gewollt zu suggerieren, dass der Menstruationszyklus selbst eine Form von Krankheit darstellt oder eine „biologische“ Rechtfertigung für Geschlechterungleichheit bietet. Sie erwähnt ebenfalls die Wichtigkeit der richtigen sprachlichen Beschreibung. Dazu gehört für sie Forschungsergebnisse aus neutraler Perspektive zu betrachten und vor allem „Frauen“ oder „menstruierende Personen“ als Beschreibung zu vermeiden, wenn eigentlich „Personen mit PMS“ gemeint sind, damit die Grenze zwischen dem Krankheitsbild PMS und der Menstruation selbst nicht verschwimmt. Damit kann dem Vorurteil und Mythos der „pathologisch emotionalen Frau“ entgegengearbeitet werden.
Der Mythos, dass die Menstruation schädlich und ungesund für das vaginale Mikrobiom sei, ist ebenfalls weit verbreitet und trägt dazu bei unbegründeten Ängsten über den eigenen Körper hervorzurufen. Diese Pathologisierung des natürlichen Zyklus wird als gesellschaftliches Machtinstrument benutzt und führt zu Fehleinschätzungen über den Gesundheitszustand des eigenen Körpers und fördert die Schambehaftung der Menstruation selbst (9).
Repräsentationsmangel von trans* und non-binären Menschen im Menstruationsdiskurs
Menschen, die menstruieren und nicht in die binäre Kategorie „Frau“ passen, erleben oft eine doppelte Marginalisierung. Sie werden mit den gleichen Tabus konfrontiert wie cis Frauen, aber zusätzlich auch mit der Herausforderung, dass ihre Menstruation nicht in die gesellschaftlichen genderbasierten Erwartungen passen. Dies kann zu einer verstärkten Isolation und einem Gefühl der Unsichtbarkeit führen.
Um einen nicht-pathologisierenden Diskurs über Körper und Erfahrungen von trans* Personen und nicht binären Personen zu fördern, ist es essenziell, Perspektiven dieser Personengruppe im Menstruationsdiskurs einzubeziehen. Die Menstruation ist dabei nicht nur ein körperliches Phänomen, sondern auch eng mit gesellschaftlichen Erwartungen, Normen und Vorstellungen von Weiblichkeit verwoben (3).
Die Vorstellung von Weiblichkeit ist durch sichtbare und unsichtbare Normen geprägt, die den weiblichen Körper und seine Funktionen definieren. Trans* Personen und nicht-binäre Menschen, die menstruieren, stehen vor der Herausforderung, ihre Identität gegen gesellschaftlich geprägte Vorstellungen vom weiblichen Körper zu behaupten. Traditionell wurde die Menstruation ausschließlich als Funktion des von der Gesellschaft als weiblich definierten Körpers verstanden. Für trans* und nicht-binäre Personen kann diese biologische Funktion jedoch zu einem gesellschaftlichen Marker für Geschlechts- oder Geschlechteridentität werden (10). So weisen Comics aus einer Studie von Sarah E. Frank (10) auf das Unwohlsein, welches trans* und nicht binäre Personen, die Menstruieren, im Umgang mit Menstruationsprodukten empfinden können. Das Abwerfen von Menstruationsprodukten etwa in der Männertoilette löst in diesem Beispiel Nervosität aus.
Werbungen für Menstruationsprodukte reproduzieren beispielsweise auch diskriminierende Sichtweisen auf die Menstruation. Eine australische Firma hat 2019 die erste Werbung veröffentlicht, in der das Menstruationsblut auf den Menstruationsprodukten nicht blau oder anderweitig gefärbt ist, sondern in der realer roter Farbe dargestellt wird (6). Dennoch wird hier weiterhin von ausschließlich Frauen und nicht von allen menstruierenden Menschen gesprochen. Damit ist das Ziel einer inklusiveren Sprache in Diskussionen rund um die Menstruation sowie geschlechtsneutrale Periodenprodukte noch lange nicht erreicht (11).
Einfluss auf Gesundheit
„period shaming“ hat einen relevanten Einfluss auf die Gesundheit menstruierender Menschen. Die Menstruation und die damit verbundene Schambehaftung führt dazu, dass Frauen und andere menstruierende Menschen sich zum Beispiel sozial isolieren, auf Sport verzichten und sogar nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen. Dies hat zum Teil tiefgreifende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen (1).
Eine Umfrage von ActionAid zum Welt-Menstruationshygienetag 2023 ergab, dass 39 % der Frauen und anderer menstruierender Menschen im Vereinigten Königreich während ihrer Periode auf Sport oder Bewegung verzichteten oder sie ausließen. In der Altersspanne 18-24 Jahre betrug dieser Anteil sogar 48 % (12).
Der stigmatisierte Status der Menstruation hat also schädliche Folgen für die Gesundheit, insbesondere das Selbstwertgefühl, das Körperbild, die Selbstpräsentation und die sexuelle Gesundheit von Mädchen und Frauen und anderen menstruierenden Personen (4). Die gesellschaftlichen Erwartungen an menstruierende Menschen und die damit verbundenen Tabus können lebensgefährliche Auswirkungen haben (13).
Ohne die nötige Unterstützung, Information und Orientierung kann die Periode, besonders die erste, eine äußerst isolierende und einsame Erfahrung sein – eine, die oft von Stigmatisierung begleitet wird. Menstruation wird als etwas Schmutziges oder Beschämendes betrachtet, das versteckt werden sollte. Dies wird deutlich bei der Betrachtung von Euphemismen, mit denen wir die Periode beschreiben, ohne das Wort „Blut“ zu verwenden, wie etwa zum Beispiel „die Zeit des Monats“ oder auch „die Erdbeerwoche“.
Der stigmatisierte Status der Menstruation hat also schädliche Folgen für die Gesundheit, insbesondere das Selbstwertgefühl, das Körperbild, die Selbstpräsentation und die sexuelle Gesundheit von Mädchen und Frauen und anderen menstruierenden Personen (4). Die gesellschaftlichen Erwartungen an menstruierende Menschen und die damit verbundenen Tabus können lebensgefährliche Auswirkungen haben (13).
Menstrual health – wo wollen wir eigentlich hin?
Menstrual health, also Menstruationsgesundheit ist ein Zustand des vollständigen physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechlichkeit im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus (14).
Das umfassende Konzept der Menstruationsgesundheit beinhaltet, dass menstruierende Personen Zugang zu angemessenen Behandlungen für menstruationsbedingte Symptome und Krankheiten sowie zu Hygieneprodukten und angemessener Pflege während der Periode haben sollten. Aufklärung und Information über Menstruation in einem Umfeld, das frei von Gewalt, Stigmatisierung und Diskriminierung ist, vervollständigen die Agenda. (15)
Alle menstruierenden Menschen sollten Zugang zu präzisen, altersgerechten Informationen über den Menstruationszyklus, Menstruation und die damit verbundenen Veränderungen im Leben haben, sowie zu Selbstpflege- und Hygienepraktiken. Sie sollten in der Lage sein, ihre Körper während der Menstruation so zu pflegen, dass ihre Vorlieben, Hygiene, Komfort, Privatsphäre und Sicherheit unterstützt werden. Dies umfasst den Zugang zu effektiven und erschwinglichen Menstruationsmaterialien sowie zu unterstützenden Einrichtungen wie Wasser-, Sanitär- und Hygienediensten. Ebenso sollten sie rechtzeitig eine Diagnose, Behandlung und Pflege bei menstruationsbedingten Beschwerden erhalten, einschließlich Schmerzlinderung und Selbstpflegestrategien. Menschen sollten ein positives, respektvolles Umfeld erleben, das frei von Stigmatisierung und psychischer Belastung ist, und die Ressourcen haben, um ihren Körper selbstbewusst zu pflegen und informierte Entscheidungen zu treffen. Zudem sollte ihnen die Freiheit gegeben sein, während aller Phasen ihres Menstruationszyklus selbst zu entscheiden, ob und wie sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – ohne Ausgrenzung, Einschränkungen, Diskriminierung, Zwang oder Gewalt (14).
Historisch entstandene Vorstellungen und Dichotomien, welche auf veralteten biologischen und medizinischen Erkenntnissen basieren, sollten kritisch hinterfragt werden. Um eine inklusive und menschliche Herangehensweise an die Menstruation zu ermöglichen sollte Gesundheit als multidimensionaler Prozess verstanden werden, indem Klassifikationssysteme nicht binär, sondern auf den Menschen bezogen arbeiten (16).
Reflexion
Mit Menstruation verbinde ich zunächst Anstrengung und Schmerzen. Gleichzeitig verbinde ich damit ein sehr vertrautes und friedliches Gefühl. Während meiner Schulzeit hätte ich diesen Satz nicht so formuliert. Dank einer offenen Herangehensweise zuhause war ich zwar gut informiert über verschieden Phasen des Zyklus, Menstruationsprodukte und mögliche Symptome, jedoch fand lange gar kein öffentlicher Diskurs in meinem sozialen Umfeld über das Thema Menstruation statt. Damit war die Menstruation zunächst ein geheimnisvolles und gefährliches Thema. Ab dem Zeitpunkt, ab dem im Sportunterricht Schulschwimmen stattfand, waren einige meiner Mitmenschen vom Unterricht entschuldigt aufgrund der Menstruation. Dies führte bei mir zu der Überzeugung, dass Sport und menstruieren nicht zeitgleich möglich wären. Zunehmend wurde die Menstruation problematisiert. Blut wurde als „eklig“ beschrieben und alle Veränderungen in der Stimmung der menstruierenden Menschen wurden damit in Verbindung gebracht. Außerdem war es kompliziert, Menstruationsprodukte mit sich zu führen ohne, dass sie von anderen bemerkt wurden, um nicht ausgelacht zu werden. Die Vorstellung, dass es an öffentlichen Orten Menstruationsprodukte zur freien Verfügung geben könnte, war zu diesem Zeitpunkt fast absurd. Am schwierigsten war insgesamt jedoch die Konnotation der ersten Menstruation und dem „Frau“ werden. Da ich mich mit dem Begriff „Frau“ ohnehin nicht wohl gefühlt habe, war es für mich sehr schwer verständlich, wieso ich damit zu einer „Frau“ wurde und inwiefern die Menstruation und die damit einhergehende Fruchtbarkeit das Wertvollste und am Frau-Sein bedeutete.
Heute kann ich diese Erfahrungen kritisch betrachten. Mehr Wissen, Austausch und Sensibilisierung auch durch eigene körperliche Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich Menstruation und vermeintliche Weiblichkeit nicht mehr miteinander verknüpfe. Es ist jedoch weiterhin in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten nicht selbstverständlich, offen über das Thema Menstruation reden zu können. Immer wieder begegne ich Situationen, wo ein Informationsdefizit vorliegt, oder mir bestimmte Attribute, wie etwa „zu emotional“ aufgrund meiner Menstruation angerechnet werden. Hierbei versuche ich mit Offenheit und Aufklärung entgegenzuwirken.
Fazit
Das Thema Menstruation ist nach wie vor von gesellschaftlichen Tabus, Stigmatisierung und Missverständnissen geprägt. Diese Haltung beeinflusst nicht nur die Wahrnehmung des eigenen Körpers, sondern führt auch zu erheblichen psychischen und physischen Belastungen für menstruierende Personen. Der Diskurs über die Menstruation sollte vom Status Quo der Pathologisierung und Scham in Richtung einer offenen, inklusiven und respektvollen Auseinandersetzung verändert werden. Die enge Verknüpfung von Menstruation und sozialen, kulturellen und politischen Dynamiken, die von Geschlechterrollen und Ungleichheiten geprägt sind, bringt die Verantwortung den Menstruationsdiskurs inklusiver und offener zu gestalten. Mythen über die Menstruation sind geschichtlich verankert und vielfältig, ihnen entgegenzuwirken ist weiterhin eine Aufgabe, der sich menstruierende Menschen täglich stellen müssen. Um die gesundheitlichen Voraussetzungen für menstruierende Menschen zu verbessern, muss es einen offenen Diskurs und ein Ende des „period shaming“ geben. Eine gendergerechte Herangehensweise trägt dazu bei, Barrieren abzubauen, Stigmata zu reduzieren und allen Menschen ein gesundes und würdevolles Leben zu ermöglichen. „Menstrual health“ ist folglich eine Zielvorstellung, welche gesamtgesellschaftlich erreicht werden sollte.
Literaturverzeichnis
1. Arif N. From shame to solidarity: how we can reverse harmful narratives on period stigma. BMJ. 2024;384:q152.
2. McHugh MC. Menstrual Shame: Exploring the Role of ‘Menstrual Moaning’. In: Bobel C, Winkler IT, Fahs B, Hasson KA, Kissling EA, Roberts T-A, editors. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Singapore: Springer Singapore; 2020. p. 409-22.
3. Frank SE, Dellaria J. Navigating the Binary: A Visual Narrative of Trans and Genderqueer Menstruation. In: Bobel C, Winkler IT, Fahs B, Hasson KA, Kissling EA, Roberts T-A, editors. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Singapore: Springer Singapore; 2020. p. 69-76.
4. Johnston-Robledo I, Chrisler JC. The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma. In: Bobel C, Winkler IT, Fahs B, Hasson KA, Kissling EA, Roberts T-A, editors. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Singapore: Springer Singapore; 2020. p. 181-99.
5. Germerott I. Blut und Scham: Wie die Menstruation zum Tabuthema wurde: National Geographic; 2023 [Available from: https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2023/03/blut-und-scham-wie-die-menstruation-zum-tabuthema-wurde-religion-patriarchat-wissenschaft-medizin.
6. Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte [Internet]; 2024 25.07.2024. Podcast. Available from: https://www.deutschlandfunk.de/menstruation-geschichte-periode-hysterie-102.html
7. King S. Premenstrual Syndrome (PMS) and the Myth of the Irrational Female. In: Bobel C, Winkler IT, Fahs B, Hasson KA, Kissling EA, Roberts T-A, editors. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Singapore: Springer Singapore; 2020. p. 287-302.
8. Manual M. Prämenstruelles Syndrom (PMS): MSD Manual; [Available from: https://www.msdmanuals.com/de/profi/gynäkologie-und-geburtshilfe/menstruationsstörungen/prämenstruelles-syndrom-pms?query=prämenstruelles%20syndrom%20(pms)#Symptome-und-Beschwerden_v1062694_de.
9. Sommer M, Chrisler JC, Yong PJ, Carneiro MM, Koistinen IS, Brown N. Menstruation myths. Nature Human Behaviour. 2024;8(11):2086-9.
10. Frank SE. Queering Menstruation: Trans and Non-Binary Identity and Body Politics. Sociological Inquiry. 2020;90(2):371-404.
11. Neve M. War on period shaming goes mainstream. Eureka street. 2019;29(17):25-7.
12. Pycroft H. Cost of living: UK period poverty has risen from 12% to 21% in a year: Actionaid; 2023 [Available from: https://www.actionaid.org.uk/blog/2023/05/26/cost-living-uk-period-poverty-risen.
13. Gottlieb A. Menstrual Taboos: Moving Beyond the Curse. In: Bobel C, Winkler IT, Fahs B, Hasson KA, Kissling EA, Roberts TA, editors. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Singapore2020. p. 143-62.
14. Hennegan J, Winkler IT, Bobel C, Keiser D, Hampton J, Larsson G, et al. Menstrual health: a definition for policy, practice, and research. Sex Reprod Health Matters. 2021;29(1):1911618.
15. Carneiro MM. The hidden tales menstruation may tell: time to break the silent spell. Women & Health. 2022;62(4):273-5.
16. Sharon G. Lifting the Curse of Menstruation : A Feminist Appraisal of the Influence of Menstruation on Women’s Lives. New York: Routledge; 2015.
Quelle: Lea Nitsch, Das Spannungsfeld des Menstruationsdiskurses in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 26.05.2025, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=494