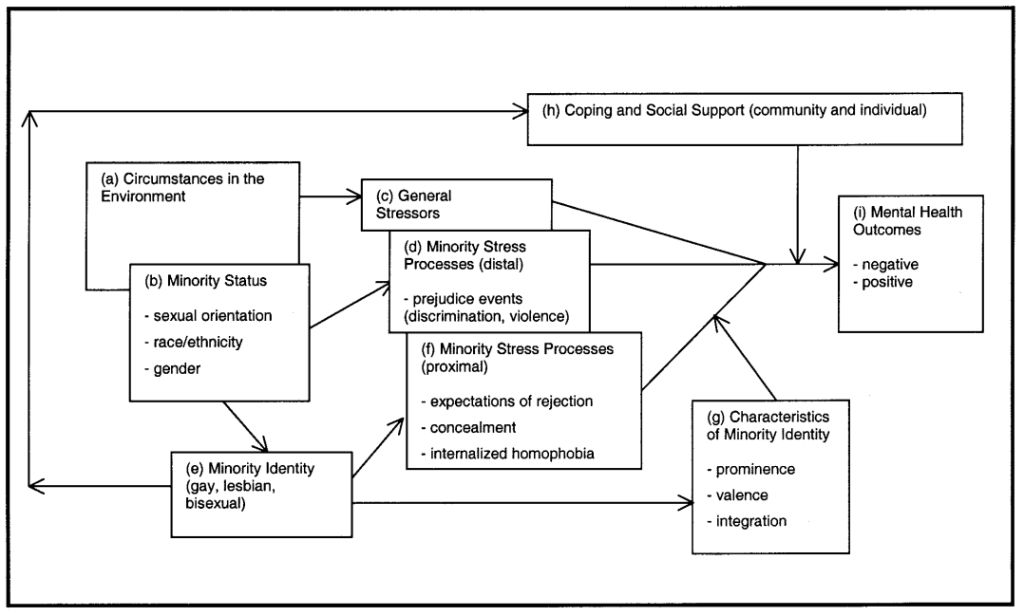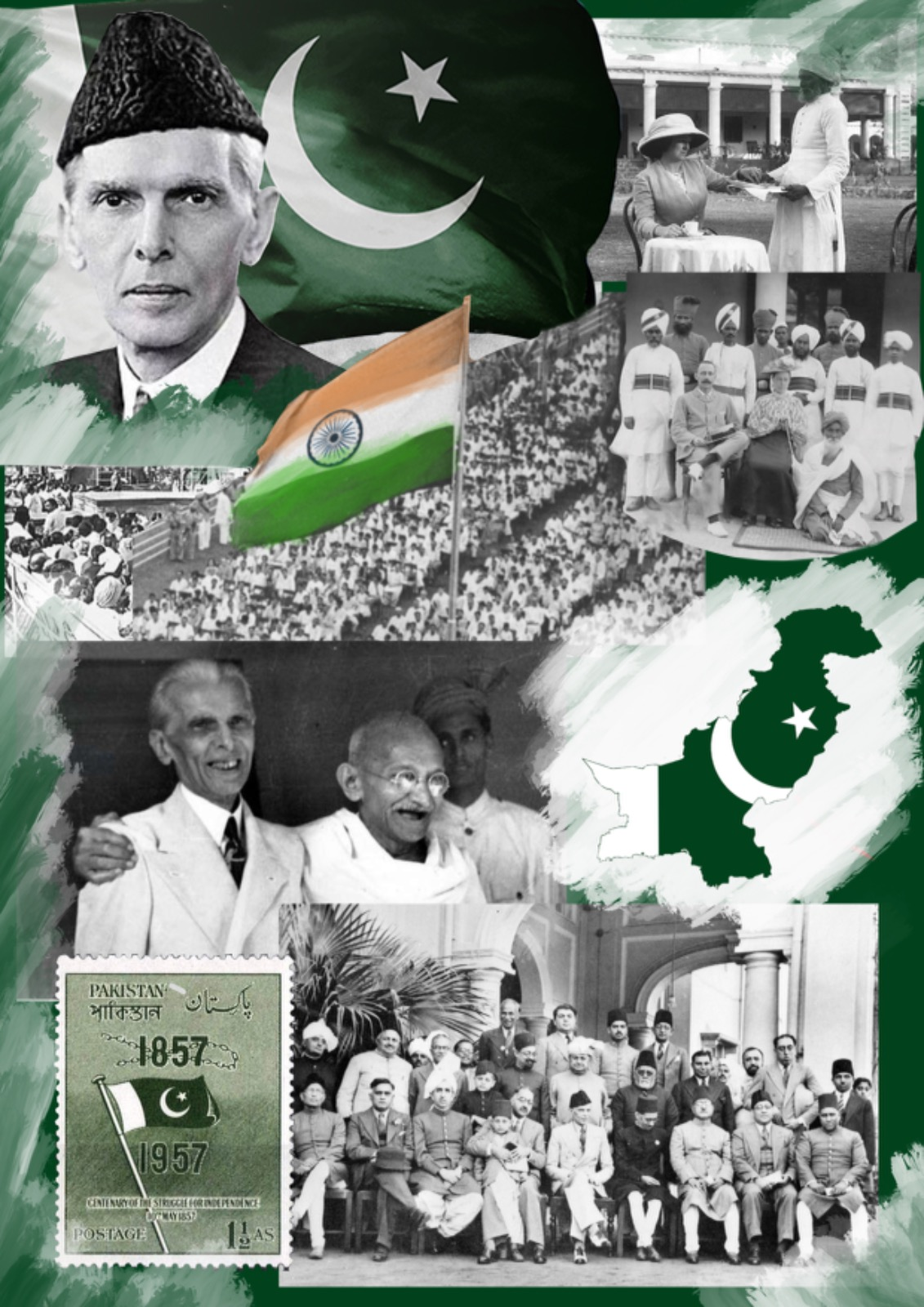Die Körperpolitik des Colorismus
Kim-Margaux Déniel (WiSe 2023/24)
1. Einleitung
Seit Beginn meiner Pubertät haben mich Themen wie das Schminken, Stylen, und die allgemeine eigene Schönheit fast täglich beschäftigt. Sei es früh morgens vor der Schule, nachmittags, bevor ich meine Freund*innen traf, oder auch abends vor Konzerten gewesen – ein „perfektes” Aussehen war in fast allen Bereichen meines Lebens ein sehr wichtiger Aspekt. Ein Thema, welches mich allerdings nie betroffen hat und mir daher größtenteils unbewusst war, beinhaltet die starke Präsenz von diskriminierenden Schönheitstrends, die von rassistischen Werten geprägt sind. Tatsächlich ist mir der Begriff „Colorism” erst seit einigen Jahren bekannt und ist mir auch seitdem erst als ein fortbestehendes, soziokulturelles Problem aufgefallen.
Im Rahmen meines Studiums und nach der Teilnahme am ABV-Modul „Gender, Diversity, Gender Mainstreaming” habe ich mich unter Anderem tiefer mit Rassismus und rassistischer Diskriminierung auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen auseinandergesetzt. Des Weiteren wurde ich für verschiedene Themenbereiche der Diskriminierung stärker sensibilisiert, was dazu führte, dass ich das Phänomen Colorismus kritisch betrachtet und näher analysiert habe. In dieser Analyse werde ich zunächst auf die Begriffsbedeutung und den historischen Kontext von Colorismus eingehen, bevor moderne Beispiele aus mehreren Berichten Colorismus als ein beständiges, allgegenwärtiges und vielschichtiges Problem verdeutlichen. Mit Hilfe von wissenschaftlicher Literatur, welche die Themen Schönheit und Colorismus aus diversen soziologischen Perspektiven behandelt, wird diese Analyse ermitteln, inwiefern Colorismus als ein komplexes, diskriminierendes und höchst schädigendes System fungiert. In diesem Text werde ich hauptsächlich den eingedeutschten Begriff „Colorismus” (vom Englischen „Colorism”) verwenden, welcher sich klar von dem Farbkonzept „Kolorismus” aus der Malerei abgrenzt.
2. Was ist Colorismus?: Begriffsklärung und historischer Ursprung
Der Begriff wurde 1982 von der afroamerikanischen Schriftstellerin Alice Walker geprägt und bezeichnet die „voreingenommene oder bevorzugte Behandlung von Menschen derselben [rassifizierten Gruppe] basierend allein auf ihrer Hautfarbe” (Igwe, 2023). Die Definition des Merriam-Webster Dictionary betont darüber hinaus, dass Menschen mit hellerer Haut gegenüber denen mit dunklerer Haut bevorzugt werden. Hierbei geht hervor, dass Colorismus sich von Rassismus unterscheidet, da er innerhalb von ethnischen und rassifizierten Gruppen stattfindet und somit nur ein bestimmter Teil dieser Gruppen diskriminiert wird. Hinzu kommt, dass Colorismus von allen ethnischen und rassifizierten Gruppen praktiziert wird und dies insofern problematisch ist, dass dadurch Spaltungen innerhalb von verschiedenen Communities, z.B. der Schwarzen Community, entstehen können (Wolf, 2021).
In einem Artikel des Studierendenmagazin der Hochschule der Medien schreibt Samira Igwe über das Stereotyp „Angry Black Woman”, also „das Narrativ der wütenden Schwarzen Frau” (Igwe, 2023), welches Betroffenen das Recht auf Wut abspricht. Samira berichtet von ihrer eigenen Erfahrungen mit dem Stereotyp und nimmt Bezug auf Colorismus, wobei sie anmerkt, dass sie selbst als „lightskinned-Schwarze Frau”[1] weniger ausgegrenzt und diskriminiert wird, als die „darkskinned-Schwarze” Perla Londole, Gründerin der Black Community Foundation in Deutschland, welche oftmals als „Angry Black Woman” abgestempelt wird. Dieses Beispiel verdeutlicht: Je heller die Hautfarbe Schwarzer Personen, desto mehr Privilegien haben sie in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, während Schwarze Personen mit dunkler Haut schlechter behandelt werden (Igwe).
Seinen Ursprung hat der Colorismus im Kolonialismus. Im US-amerikanischen Kontext basiert er auf der Versklavung von Schwarzen Menschen. Da versklavte Menschen mit hellerem Teint oftmals Familienmitglieder[2] der Sklavenhalter*innen waren, wurden sie meist bevorzugt. Dies zeigte sich vor allem in den verschiedenen Aufgabenbereichen: während Sklav*innen mit hellerer Hautfarbe oft im Haushalt arbeiteten, mussten andere versklavte Menschen mit dunklerer Hautfarbe schwere Arbeiten auf den Feldern verrichten. Folglich wurde eine helle Hautfarbe unter versklavten Menschen als Vermögenswert angesehen (Nittle, 2021). Daraus lässt sich schließen, dass Colorismus einen klaren rassistischen Ursprung hat und in einer Beziehung zu einer Hierarchie der Klassengesellschaft steht, wobei eine dunkle Hautfarbe immer unterhalb der helleren eingestuft wird.
Die historische Beziehung zum Klassismus wird noch deutlicher hinsichtlich des Colorismus in asiatischen Ländern, wo er bereits vor dem Kontakt mit Europäern und eher aus den Unterschieden zwischen der herrschenden und der Bauernklasse entstand. Die gebräunte Haut von Menschen der Bauernklasse wurde zu einem klaren Merkmal eines unterprivilegierten Status, während ein heller Teint mit der Elite assoziiert wurde (Nittle, 2021). Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass der heutige Colorismus im asiatischen Raum auf dieser Vorgeschichte basiert und weiterhin von kulturellen westlichen Einflüssen verstärkt wird.
3. Colorismus in der heutigen Zeit: ein vielschichtiges „Subsystem”
Mit dem Wissen, dass Colorismus stark mit Rassismus und Klassismus zusammenhängt, ist es nicht verwunderlich, dass dieser sich ebenfalls in vielen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen als präsent und wirkungsvoll erweist. Von medialer Repräsentation, über Einstellungen im Beruf, bis hin zu alltäglichen Dingen wie Seifenspendern und Snapchat Filtern, die dunkle Haut nicht als menschlich identifizieren. Diese Allgegenwärtigkeit deutet auf ein systematisches Machtgefüge hin, dessen Funktionsweise Prof. Dr. Maisha-Maureen Auma darin sieht, “hierarchisch zu positionieren, zu marginalisieren und auszuschließen” (Auma, 2020).
Des Weiteren bezeichnet die Professorin Colorismus als ein Subsystem bzw. eine bedeutende Technik der rassistischen Ordnung, welche dazu dient, Rassismus durch Unterschiede der Hautpigmentierung zu begründen. Folglich liegt es für weiße Privilegierte somit in der Natur, und nicht am Menschen, dass Schwarze Menschen rassifiziert werden. Negative Eigenschaften wie Kriminalität, Faulheit und Emotionalität wurden in weißen Mehrheitsgesellschaften historisch mit Schwarzen Menschen assoziiert, wobei die Hautfarbe „zu einer folgenreichen Unterscheidungskategorie aufgeladen” wurde (Auma, 2020).
Das bereits erwähnte Stereotyp „Angry Black Woman” ist ein klares Beispiel dafür, wie sich bestimmte Assoziationen mit dunkler Hautfarbe in medialer Repräsentation sowie in zwischenmenschlichen Interaktionen offenbaren und widerspiegeln. Ein wiederkehrendes Motiv in Serien und Filmen ist die lightskinned Frau, welche oftmals als sehr hübsch, freundlich, und wohlerzogen dargestellt wird, wohingegen ihre darkskinned Freundin entgegengesetzte Eigenschaften präsentiert, sprich Boshaftigkeit, Unerzogenheit und Verbitterung.
In der US-amerikanischen Netflix Serie Dear White People (2017-2021) wird das Stereotyp der „Angry Black Woman” zum Teil von der Figur Joelle Brooks verkörpert, dessen beste Freundin und Hauptfigur Samantha White ein „lightskin privilege” besitzt. Auch durch Coco Conners, eine weitere Freundin von Samantha, wird Colorismus in der Serie deutlich und kritisch behandelt. Während die Aktivistin Samantha versucht, ihr eigenes lightskin und „white privilege”[3] zu überkompensieren (Willer, 2021), indem sie sich besonders stark für die Schwarze Community und das Black Movement an ihrer Universität engagiert, hält Coco sich diesbezüglich zurück. Da sie aus armen Familienverhältnissen kommt und als darkskinned Frau sehr viel unterprivilegierter ist als lightskinned Frauen*, musste sie lernen, sich der weißen Gesellschaft anzupassen. Ein Merkmal, welches dies veranschaulicht, sind Coco’s glatte, unnatürliche Haare, die im Gegensatz zu den natürlichen Haaren von Samantha stehen.
Das Thema Haare wird unter anderem in der Serie thematisiert, als die beiden Freundinnen sich über ihre unterschiedlichen sozialen Privilegien streiten. Diese dargestellte Selbstreflexion führt dazu, dass Samantha ihr lightskin Privileg als solches erkennt und sich bei Coco für ihre frühere Ignoranz entschuldigt.
Es wird demnach deutlich, dass der Colorismus oft über Hautfarbe hinausgeht, und Haarstruktur ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Das vorherrschende rassistische und klassistische europäische Schönheitsideal ist im Colorismus zentral. In den folgenden Sektionen werde ich anhand von persönlichen Berichten und einem viralen Modetrend näher auf die Beziehung zwischen gesellschaftlichen Vorstellungen von Schönheit und Colorismus eingehen.
3.1. „Je weißer, desto schöner”: Colorismus als Schönheitsmaßstab
In ihrem TEDx Talk „Confessions of a D Girl: Colorism and Global Standards of Beauty” (dt.: „Geständnisse eines D Girls: Colorismus und globale Schönheitsstandards”) aus dem Jahr 2016, spricht Chika Okoro über die schädigenden Auswirkungen von Colorismus auf Selbstliebe und das Selbstwertgefühl von schwarzen Frauen* mit dunklem Hautton. Zunächst berichtet sie von ihrer Entdeckung der überaus problematischen Maßstäbe für bestimmte Rollen in dem Film Straight Outta Compton (2015). Die Kategorien im Casting-Aufruf verdeutlichen ihr, dass sie unter die letzte Kategorie der „D girls” fällt, welche sich auf arme schwarze Frauen bezieht, die in „keiner guten Form” sind und einen dunkleren Hautton besitzen müssen. Konträr dazu setzen die vorherigen Kategorien (A-C) hellere Hauttöne sowie natürliches langes Haar voraus, wobei die Kategorie der “A girls” sich auf die “heißesten Models” bezieht.
Chika Okoro beschreibt ein Gefühl des Verrats, welches sie durch die Realisierung überkommt, dass es ihr selbst innerhalb einer rassifizierten Gruppe, die ohnehin schon selten auf der großen Leinwand repräsentiert wird, verwehrt wird, sich schön zu fühlen. Doch dieses Gefühl wird zu einer zwangsläufigen Akzeptanz, da subtiler Colorismus ihr in nahezu allen Lebensbereichen deutlich wird. Weniger subtil sind hingegen Testmethoden wie der Papiertüten-Test, um Hauttöne zu prüfen, der Stifttest, welcher Haarstrukturen prüft, und der Schattentest, um Gesichtsmerkmale abzugrenzen. Diese Methoden werden unter anderem von Elite-Gruppen (bspw. US Schwesternschaften) genutzt, um Personen und vor allem Frauen*, welche zu weit von den äußerlichen europäischen Körpermerkmalen abweichen (d.h. dunklere Hautfarbe, krauses Haar, ‘nicht weiße’ Gesichtszüge), auszugrenzen.
Auch hiermit wird erneut klar, dass Colorismus neben der Hautfarbe alle äußerlichen Merkmale mit einbezieht, welche ein gewisses Schönheitsideal widerspiegeln. Durch die historischen Auswirkungen des Kolonialismus sind Haar-Differenzierungen bis heute bei schwarzen Frauen, wie Schönheitsideale und Weiblichkeit verbunden. Dies reflektiert die Aufrechterhaltung rassistischer Gegensätze, wobei die ‘gerade Haar-Regel’ als Bestandteil kolonialer und rassistischer Ideologien dient (Ellis & Destine, 2023, S.8).
In dem Buch Projekt Körper: Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt (2009) spricht Waltraud Posch von der Entstehung von Körperklassen im Neoliberalismus, welche bestimmte Körperideale bevorzugen und andere durch Selektionsmechanismen ausgrenzen. Das dadurch gebildete System der Attraktivität beeinflusst die soziale Hierarchie, in welcher Schönheit sich als eigene Klasse etabliert hat (Posch, 2009, S.64-65). Daraus lässt sich schließen, dass vorherrschende Schönheitsideale direkt mit einer Einstufung in gesellschaftliche Klassen einhergehen, wobei unerwünschte Körper abgewertet und ausgeschlossen werden. Des Weiteren sorgen möglichst unerreichbare Normen dafür, dass diejenigen, die sie erreichen, als „besonders gut, toll, fit, [und] erfolgreich” gelten (Posch, S.65). Je weniger Menschen sich also dem Idealkörper nähern können, desto erfolgreicher sind die körperlich Erfolgreichen.
In den Fällen von Chika Okoro und dem fiktiven Charakter Coco Conners wird diese Einstufung, wie sich zeigt, neben dem Rassismus sehr stark vom Colorismus bestimmt. Beide Beispiele werfen ein Licht darauf, wie tief coloristische Wertvorstellungen in der Gesellschaft verankert sind und dass diese sich vehement auf das Selbstwertgefühl von jenen auswirken, die aus der ‘Schönheitsnorm’ fallen. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist, dass Körperlichkeit, im Sinne von Mode oder grundlegender Körperdimensionen, eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Darstellung von Identität spielt. Sei es die Wahl der Kleidung, die Nähe zu Schönheitsstandards, oder die Inszenierung der Persönlichkeit durch Mode und Körperlichkeit – all das trägt zur Identitätsbildung bei (Posch, 2009, S.37). Daher ist es nicht verwunderlich, wenn auch problematisch, dass viele Menschen mithilfe von kostspieligen und/oder sogar gesundheitsschädlichen Mitteln versuchen, dem idealen Aussehen so nahe wie möglich zu kommen.
3.2. Obsession „Weiß-sein”: Auswirkungen auf persönliches Handeln
Wie bereits erwähnt, ist Colorismus ein globales Phänomen, welches People of Color aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen betrifft. Neben Chika Okoro’s US-bezogenen TEDx Talk gibt es noch viele weitere Berichte über Colorismus von Menschen und Frauen* unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Beispielsweise berichtet Bianca Punzalan von Colorismus in den Philippinen, und Waseka Nahar spricht über ihre Erfahrungen als “brown girl” in Südasien. Beide Sprecherinnen thematisieren die großflächige Vermarktung und Begünstigung von weißer Haut durch hautaufhellende Cremes und Mittel. Auch die exzessive Verwendung von Sonnencreme soll in den Philippinen nicht bloß gesundheitsbedingt sein, sondern hängt laut Punzalan sehr stark mit dem Schönheitsideal heller oder weißer Haut zusammen.
In Punzalan’s Bericht (2021) wird deutlich, wie sehr sich das Verinnerlichen und Bewerben dieses Ideals von der eigenen Familie auf junge Menschen auswirken kann. Da braune Haut in den Philippinen als “dreckig, hässlich, und arm” betrachtet wird und oft Sprüche fallen wie „Du bist hübsch, für eine dunkle Person”, hat Punzalan zwangsläufig versucht, sich dem Schönheitsideal trotz schmerzhafter Methoden immer weiter zu nähern. Auch die beiden Schweizerinnen Dhiviyaa Satkunanathan und Claire Bengue erzählen in der Reportage „Hau(p)tsache hell – Das Geschäft mit dunkler Haut” (2021) von ihren zwanghaften, familiär geförderten Versuchen, einen helleren Hautton durch Bleichcremes und Seifen zu erreichen. Dies verursachte bei Bengue einmal eine Hautverbrennung. Ein permanentes negatives Feedback zur „zu dunklen” Hautfarbe führt demnach häufig dazu, dass Betroffene trotz eigener Gesundheitsgefährdung mit Hilfe von entsprechenden (und weit verbreiteten) Produkten und Methoden alles versuchen, um ihre Haut aufzuhellen.
Daraus lässt sich also folgern, dass rassifizierte Schönheit eine Kommodifizierung heller Haut mit sich bringt, was die Hautaufhellungsindustrie zu einem Millionen-Dollar-Geschäft macht. Zudem fördern coloristische Ideale und deren Vermarktung die Selbstabwertung betroffener Menschen sowie das weiße Überlegenheitsdenken als Begleiter des europäischen Kolonialismus (Ellis & Destine, 2023, S.7). Im asiatischen Raum steht helle Haut für Modernität und soziale Mobilität, weshalb weißes Bleipulver von asiatischen Frauen* der Oberschicht historisch oft verwendet wurde (Ellis & Destine, S.9). Demzufolge kann Colorismus als ein Subsystem des Rassismus betrachtet werden, welches sich auf die komplexen Strukturen des Klassismus, Sexismus, und Kapitalismus stützt, und somit durch mehrere zusammenhängende Faktoren weitergeführt wird.
Waltraud Posch betont, dass Körpermanipulationen als Mittel zweier gegensätzlicher Verhaltensweisen dienen: zum einen der Unterwerfung und zum anderen der Selbstbestimmung. Somit können sie gleichzeitig für Unterdrückung sowie für Freiheit stehen (Posch, 2009, S.166). Des Weiteren muss klargestellt werden, dass Schönheitshandeln kein privates Handeln ist, denn es „verlangt nach dem Blick der anderen und ist ein Akt der Kommunikation” (Posch, S. 166). Ebenso wenig stellt Schönheitshandeln reinen Spaß, reine ‘Frauensache’, oder bloß ein Oberflächenphänomen dar; denn tatsächlich ist es ein identitätsstiftender Akt (Posch, S. 166).
Die vorgestellten Fälle dienen dafür als klare Beispiele. Colorismus ist zwar häufig ein geschlechtsspezifisches Phänomen, welches Frauen* überproportional betrifft (Ellis & Destine, 2023, S.2), jedoch kann er ebenso von Menschen aller Geschlechtszugehörigkeiten erfahren werden. Der Zusammenhang von sozialem Geschlecht und dunkler Hautfarbe kann hier, wie auch in einigen Formen des Rassismus, auf gesellschaftliche Vorstellungen von Schönheit und Weiblichkeit zurückgeführt werden. In diesem Kontext können Methoden der Hautaufhellung eine Unterdrückung im Sinne der Konformität (Weiß-sein = „schön” sein) widerspiegeln, was jedoch für einige gewisse Freiheiten mit sich bringt. Wenn hellere Haut soziale Inklusion und bessere Behandlung bedeutet, wird sie als ein Kapital gesehen, welches eindeutig mehr Chancen und Privilegien bietet als dunklere Haut. Ob dies echte Freiheit darstellt, gilt definitiv zu hinterfragen. Vielmehr mögen die positiven Effekte derartiger Körpermanipulationen eine Freiheit vortäuschen, die auf höchst problematischen sozialen Dynamiken und Werten basiert, und das auf Kosten des Selbstwertgefühls und der körperlichen Akzeptanz.
4. Fazit: Social-Media Einfluss: Was ist vor allem heute wichtig?
Das heutige Zeitalter der „Social Media Generation” bietet eine riesige Fläche für die regelmäßige Verbreitung bestimmter Bilder und Einflüsse, weshalb das Internet als relevantes und integrales Kulturobjekt gilt. Von User*innen und prominenten Personen, die gewisse Körper, Standards, und Ästhetiken präsentieren, bis hin zu Fotobearbeitungstools, durch welche Selfies schnell und einfach „verschönert” oder gar verfremdet werden können – ein Entkommen der modernen Schönheitsideale ist nahezu unmöglich. Auch im Kontext des Colorismus stellen scheinbar harmlose, hautaufhellende Gesichtsfilter, oder Trends wie der „Clean Girl Look”[4] eine gefährliche Kontinuität der bereits bestehenden (selbst)abwertenden Ansichten und Praktiken dar. Umso wichtiger ist es, öffentliche Inhalte und Plattformen einerseits kritisch zu betrachten und andererseits als Tool für mehr Aufklärung, Sichtbarkeit, und Diversity-Förderung wahrzunehmen.
Literaturverzeichnis / Referenzen
Auma, M.-M. (2020, July 27). Maisha-Maureen Auma: “Rassismus Hat übrigens nichts mit der Hautfarbe zu tun.” ZEIT Campus. https://www.zeit.de/campus/2020-07/maureenmaisha-auma-erziehungswissenschaftlerin-colorism-schwarze-community-rassismus.
Ellis, N. P., & Destine, S. (2023). Color capital: Examining the racialized nature of beauty via colorism and skin bleaching. Sociology Compass, 17(8), e13049.
Igwe, S. (2023, December 7). Wer hat Angst vor der Schwarzen Frau?. edit. Magazin. https://www.edit-magazin.de/wer-hat-angst-vor-der-schwarzen-frau.html.
Nahar, W. (2019, May 1). Finding Self Love in a World of Colorism | Waseka Nahar | TEDxEMWS. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iNFX26_5NIY.
Nittle, N. K. (2021, February 28). The Roots of Colorism, or Skin Tone Discrimination. ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/what-is-colorism-2834952.
Okoro, C. (2016, May 23). Confessions of a D girl: Colorism and Global Standards of Beauty | Chika Okoro | tedxstanford. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fvoWoMIwr-g&t=192s.
Posch, W. (2009). Projekt Körper: Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt. Campus.
Punzalan, B. (2021, June 2). Colorism in the Philippines | Bianca Punzalan | TEDxMoreauCatholicHS. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dbK4yyUTie0&t=73s.
Urbančik, J. (2024, April 5). Gründe, warum du den Clean Girl Look nicht nachstylen solltest. wmn. https://www.wmn.de/beauty/fashion/clean-girl-look-problematisch-a-did421334.
Willer, M. (2020, June 17). The Women in “Dear White People.” FemCinema. https://femcinema.home.blog/2020/06/17/the-women-in-dear-white-people/.
Wolf, F. (2021, February 19). Colorism: Ein Gefährliches Überbleibsel des Kolonialismus. wmn. https://www.wmn.de/buzz/colorism-bedeutung-id34489.
Yogarasa, S. (2021, May 25). Hau(p)tsache Hell – Das Geschäft mit dunkler haut. colorism. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DY8HyjJpwr8&t=1s.
[1] „lightskinned” beschreibt eine Schwarze Person mit vergleichsweise hellem Hautton, während „darkskinned” sich auf Schwarze Personen mit dunklerem Hautton bezieht. Die Begriffe werden auch im deutschen Diskurs verwendet, u.a. von der Erziehungs- und Genderwissenschaftlerin Prof. Dr. Maisha-Maureen Auma. Sie betont, dass solange die deutsche Sprache noch nicht genug für die anerkennende Beziehung zwischen Schwarzen Menschen und ihren Körpern hergibt, englische Begriffe benutzt werden müssen (zeit).
[2] Kinder von versklavten Menschen und Sklavenhalter*innen waren meist das Ergebnis von sexuellen Übergriffen, bei dem die versklavten Menschen zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurden.
[3] Samantha White ist die Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters, und somit “biracial”.
[4]„Clean Girl Look”: eine Stil-Ästhetik, die minimales und ‘sauberes’ Make-Up sowie Kleidungs- und Lebensstil darstellen soll. Er wurde mehrfach dafür kritisiert, dass er ausgrenzend, und ausschließlich auf ‘hübsche’, dünne, und weiße Frauen* ausgerichtet sei. Vor allem das schlichte Make-Up wurde von Schwarzen Creator*innen als spezifisch für weiße Menschen bezeichnet (Urbancik, 2024).
Quelle: Kim-Margaux Déniel, Diskriminierung und Selbsthass durch rassistisch geprägte Schönheitsideale: Die Körperpolitik des Colorismus in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 08.07.2024, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=459