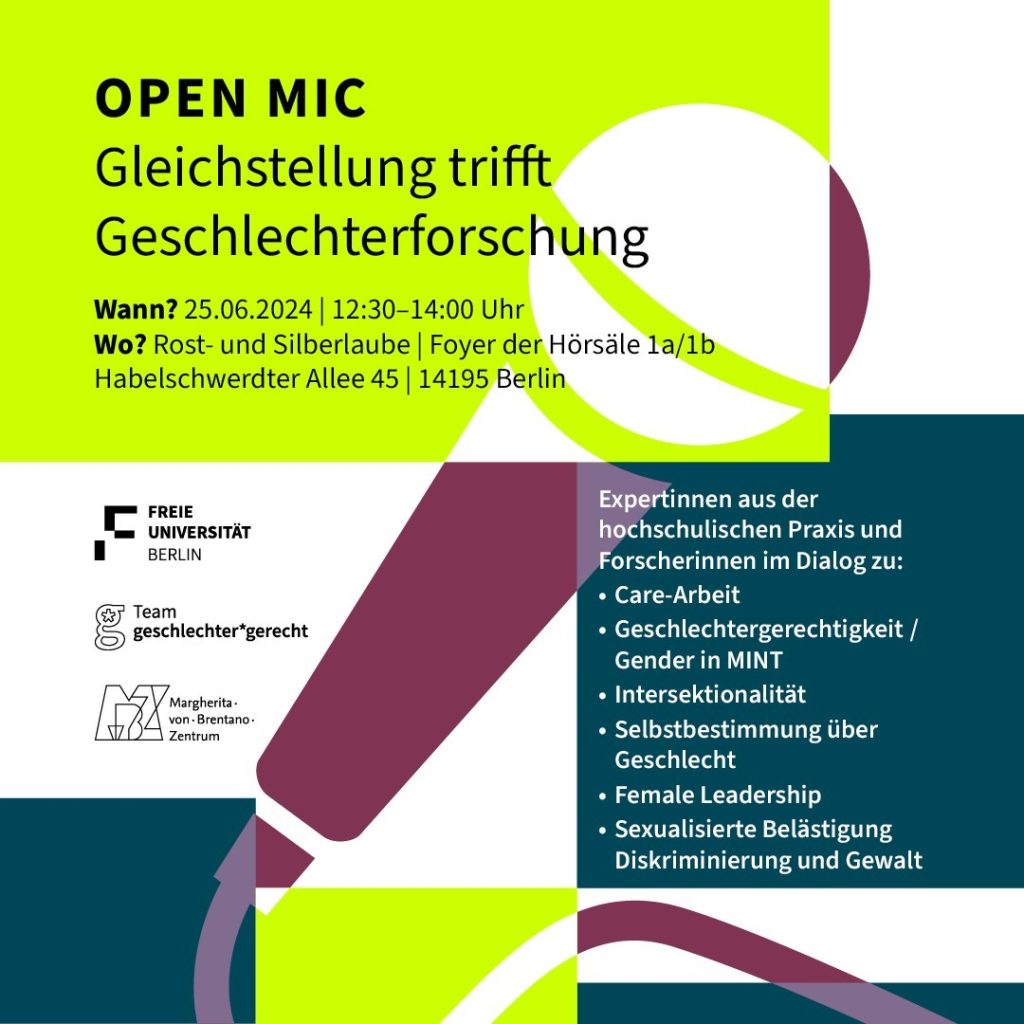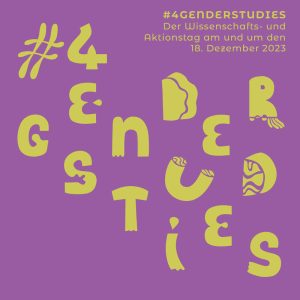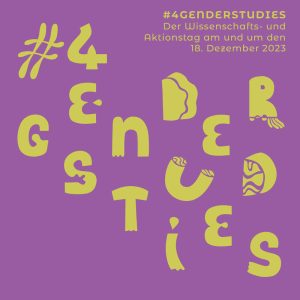
Rund um den 18. Dezember findet der jährliche Wissenschaftstag #4GenderStudies bereits zum siebten Mal statt. Geschlechterforscher*innen, Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterstudien sowie Hochschulen im deutschsprachigen Raum beteiligen sich mit dem Ziel, die Vielfalt der Geschlechterstudien zu präsentieren und die wissenschaftliche Bedeutung dieses Forschungsfeldes deutlich zu machen.
In diesem Kontext möchten wir auf folgende Aktionen aufmerksam machen:
Am Dienstag, den 19. Dezember um 16:00 Uhr, veranstaltet das Margherita-von-Brentano-Zentrum einen Kinoabend im Hörsaal 2 (Rostlaube) mit der Vorführung des Dokumentarfilms FEMINISM WTF von Katharina Mueckstein aus dem Jahr 2023. Der Eintritt ist frei, und der Film wird auf Deutsch mit englischen Untertiteln gezeigt. Weitere Informationen unter: https://www.mvbz.fu-berlin.de/termine/20231218_feminism_wtf.html
Zusätzlich möchten wir die Ergebnisse eines Studierendenprojekts vorstellen, das im Rahmen des Seminars „Geschlechterpolitik in der Wissenschaftskommunikation“ im Masterstudiengang Intersektionalität & Politik an der Freien Universität Berlin entstanden ist. Das Ziel dieses Projekts ist es, die Stimmen der Studierenden zu Gehör zu bringen und ihre Einschätzungen zum aktuellen Angebot sowie zur Relevanz von Gender Studies und Intersektionalität zu sammeln, auszuwerten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Projektergebnisse sind hier zu finden: https://www.mvbz.fu-berlin.de/wissenschaftskommunikation/wissenschaftstag_4genderstudies/projektbericht_4genderstudies/index.html
Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Wissenschaftstags werden unter #4GenderStudies auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft der Frauen- und Geschlechterforschungseinrichtungen Berliner Hochschulen (afg berlin) geteilt: https://afg-berliner-hochschulen.de/4genderstudies
Wir würden uns freuen, viele von Ihnen bei diesen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!