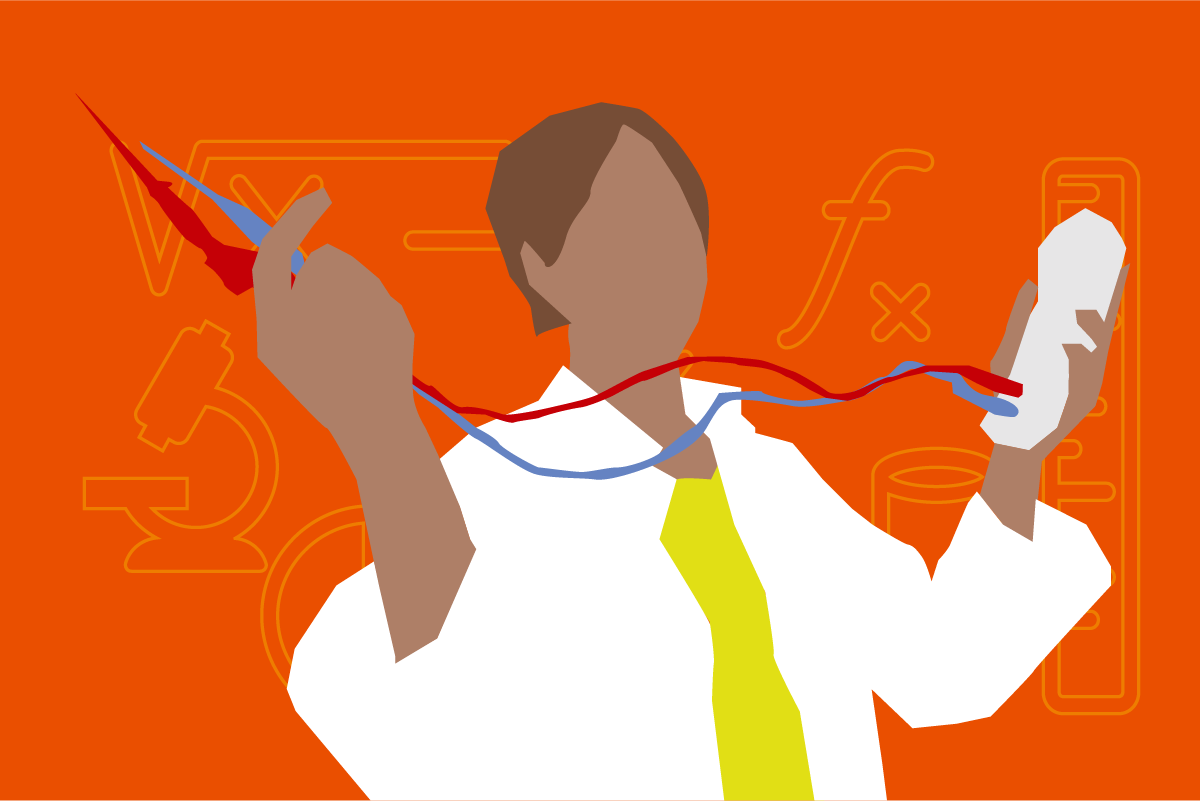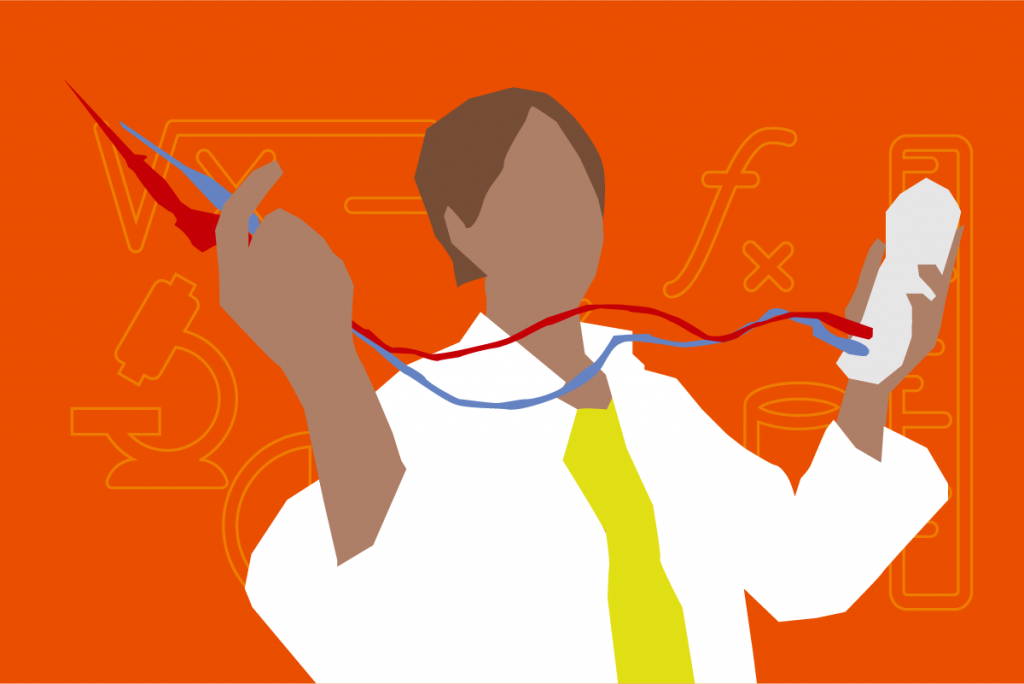
Christiane Koch, Professorin für Theoretische Physik an der Freien Universität, berichtet im Interview über ihren Weg in die Physik und die Wissenschaft. Anhaltende Freude an der Arbeit und internationale Kooperationen kennzeichnen ihn ebenso wie Durststrecken und erfahrene Unterstützung, u.a. durch das ProFiL-Programm.
Nach dem Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin und der University of Texas in Austin promovierte die Physikerin am Fritz-Haber-Institut in Berlin. Für ihre Dissertation erhielt sie die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft. Als junge Wissenschaftlerin wirkte sie an Forschungsprojekten in Deutschland, Israel und Frankreich mit. 2010 folgte sie einem Ruf an die Universität Kassel, seit 2019 leitet sie die Arbeitsgruppe Quantendynamik und -kontrolle am Fachbereich Physik der Freien Universität. Als Mentorin für Graduiertenschulen unterstützt sie Nachwuchswissenschaftler*innen in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn.
„Die Faszination begleitet mich seit fast 30 Jahren.“
Was begeistert Sie an Ihrem Fach?
Bis heute begeistert mich die Idee, mit mathematischen Methoden Wirklichkeit beschreiben und sie dadurch besser verstehen zu können. Diese Faszination begleitet mich seit fast 30 Jahren. Außerdem wird es in meinem Fach nie langweilig. Ich kann immer wieder über neue Fragen nachdenken und dabei Neues entdecken. Nicht zuletzt finde ich es toll, dass man mit Menschen aus aller Welt zusammenarbeitet und über Konferenzbesuche und Forschungsaufenthalte auch sehr viel von der Welt sieht.

Wann wurde Ihr Interesse für Ihr Fach geweckt?
Das war kurz vor dem Abitur, vorher fand ich Physik total langweilig. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich Physik abgewählt! Aber in der DDR waren sämtliche Naturwissenschaften von der Mittelstufe bis zum Abitur für alle verpflichtend.
Erst in der 10. Klasse wurde es ein bisschen besser, da kam Optik dran. In der 11., 12. Klasse gab es dann ein paar Wochen zu Quantenmechanik. Das fand ich plötzlich sehr spannend. Parallel dazu ging es im Chemieunterricht um den Aufbau des Atoms, die Elektronenhülle, das sind im Prinzip alles physikalische Modelle. Später am Leibniz Kolleg habe ich verstanden, dass sich mein Interesse an der mathematischen Beschreibung molekularer Prozesse am besten in einem Physik-Studium vertiefen lässt.
Zuvor hatte ich mich für ein Dolmetscherstudium an der Universität Leipzig beworben. Für die Aufnahmeprüfung musste ich ein Rollenspiel übersetzen, in dem ein wohlhabender Mann einer alleinerziehenden Frau mit vier Kindern kurz vor der Währungsunion anbietet zu heiraten, damit er einen größeren Teil seiner DDR-Mark eins zu eins in D-Mark umtauschen kann. Hinterher könnten sie sich ja wieder scheiden lassen und das Geld aufteilen. Diese Prüfung war für mich ein Schlüsselmoment: Ich war empört und fragte mich, ob eine Dolmetscherin übersetzen muss, was auch immer die Leute ihr auftragen. Das wollte ich nicht! Daraufhin habe ich beschlossen, mich umzusehen. Es war ja Wendezeit, plötzlich war alles möglich.
„Das Wichtigste ist die Motivation!“
Wer oder was hat Ihre Entscheidung, ein mathematisch-naturwissenschaftliches Studium aufzunehmen und abzuschließen, bestärkt und gefördert?
Mein Interessenspektrum war sehr breit – von Philosophie und Politikwissenschaften bis Physik und Chemie. Daher besuchte ich das Leibniz Kolleg in Tübingen. Das warb mit der Frage „Abitur? Was nun?“. Das traf genau auf mich zu. Die Schnupperkurse am Kolleg waren entscheidend, um in Richtung Naturwissenschaften zu gehen. Der letzte Baustein war ein Betreuer in der theoretischen Chemie. Er hat mich bestärkt, mit meinem Interesse an theoretischer Modellbildung unbedingt Physik zu studieren und nicht Chemie, weil der Theorieanteil im Physikstudium viel größer sei. Bis dahin war Physik für mich etwas sehr Abgehobenes, das nur Genies können. Er aber sagte: „Nein, das Wichtigste ist die Motivation!“
Ein entscheidender Punkt nach dem Studium war meine Zeit in Israel während der Doktorarbeit. Zu meinem Mentor vor Ort hatte ich ein sehr persönliches Verhältnis, das viel offenere und leidenschaftlichere Diskussionen ermöglichte, als das hierzulande meistens der Fall ist. Das war auf jeden Fall ausschlaggebend dafür, dass ich auch nach der Promotion in der Wissenschaft geblieben bin.
„Dann kann ich es auch versuchen mit der akademischen Karriere.“
Was waren die wichtigsten Stationen auf Ihrem Weg zur Professur?
Die doppelte Anbindung in Berlin und Jerusalem war für meine Laufbahn sehr wichtig. Nach meiner Diplomarbeit hatte ich mich erfolgreich für eine Promotion am Fritz-Haber-Institut in Berlin beworben. Ein Drittel dieser Zeit war ich de facto in Jerusalem. Die Entscheidung für die Promotion war auch darin begründet, dass sie der notwendige nächste Schritt einer wissenschaftlichen Ausbildung ist, die international anerkannt ist. Nach der Promotion war für mich weniger wichtig, wie ich meine Karriere optimieren kann, sondern wichtiger, was mir Spaß macht und was mich interessiert. Ich wollte gerne noch einmal längere Zeit im Ausland leben. Mit meiner Lebensgefährtin bin ich dann zwei Jahre nach Paris gegangen. Im Anschluss war ich ein weiteres Jahr in Jerusalem. Vorher hatte ich mich bereits für das Emmy Noether-Programm der DFG beworben, mit dem ich schließlich als Leitung einer Nachwuchsgruppe im April 2006 an die FU kam. In der Postdoc-Phase war mir klar geworden, dass ich so viele Ideen habe, die ich gar nicht alle alleine bearbeiten kann, und ich dachte, dann kann ich es auch versuchen mit der akademischen Karriere.
Nach meinem Wechsel an die FU habe ich relativ schnell am ProFiL-Programm teilgenommen, einem Mentoring-Programm für Wissenschaftlerinnen. Das war extrem hilfreich, um meine weitere Laufbahn strategisch anzugehen. Aufgrund von ProFiL habe ich mich sehr viel früher auf Professuren beworben, als ich es sonst gemacht hätte. Die Empfehlung war: „Lieber zu früh als zu spät!“ Man sammelt so auch Erfahrungen, man erhält ja niemals gleich bei der ersten Bewerbung einen Ruf. Bereits 2008 wurde ich zum ersten Mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, 2009 gleich mehrmals. Anfang 2010, noch vor Ablauf der Emmy Noether-Gruppe, erhielt ich drei Rufe, unter anderem den nach Kassel, den ich angenommen habe.
Welche Phasen Ihrer Laufbahn haben Sie als besonders herausfordernd erlebt und was hat Ihnen geholfen, die Herausforderung zu bewältigen?
Als besonders herausfordernd empfand ich die Zeit kurz vor der Zwischenevaluation des Emmy Noether-Programms. Nach zwei Jahren gab es eine echte Durststrecke, da ging es überhaupt nicht vorwärts. Da habe ich zum ersten Mal einen existenziellen Druck gespürt. Geholfen hat mir in dieser Zeit der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich kooperiert habe, einschließlich des Mentors aus Jerusalem. Die haben mir vermittelt, dass sie schätzen, was ich tue. Das fachliche Feedback der Community, dass es in die richtige Richtung geht, war wichtig. Außerdem braucht man die psychologischen Ressourcen, so etwas durchzustehen. Ich hatte immer Unterstützung durch meine Lebensgefährtin. Wenn das nicht hundertprozentig klar ist, dann wird es sehr schwer.
„Kolleginnen, die 10, 15 Jahre älter sind, hatten es ungleich schwerer.“
Inwiefern hat Ihr Geschlecht in Ihrer Laufbahn eine Rolle gespielt?
Das hat natürlich eine Rolle gespielt, allein schon dadurch, dass Physik ein absolutes Männerfach ist. Die Minderheitenposition als Frau hat Vor- und Nachteile. Dadurch war ich sehr exponiert. Das hatte den Vorteil, dass ich schneller wahrgenommen wurde. In meinem Studium habe ich tatsächlich nur einen Professor erlebt, der offen frauenfeindlich und sexistisch war. Wir waren fünf Frauen unter ungefähr 40 Studierenden. Nach dem Vordiplom war nur noch die Hälfte der Studierenden übrig, was in der Physik ganz typisch ist, aber immer noch die fünf Frauen. Sie haben später auch alle ihr Diplom abgeschlossen. Offensichtlich hatten sich das alle sehr gut überlegt.
Die Hindernisse nehme ich jetzt erst wahr, in den letzten Jahren, dieses Phänomen der „Gläsernen Decke“. Gerade wenn es um die höheren Positionen geht, gibt es nach wie vor Strukturen, die den Aufstieg von Frauen behindern. Auf dem Weg zur Professur braucht man enormes Durchhaltevermögen, es gibt große Durststrecken, man braucht Unterstützung. Mittlerweile gibt es auch sehr viel Unterstützung. Kolleginnen, die 10, 15 Jahre älter sind, hatten es ungleich schwerer. Der Max-Planck-Direktor, in dessen Abteilung ich tätig war, hat talentierte Frauen, darunter auch mich, in jeder Hinsicht unterstützt.
„Man muss sich durchbeißen, wenn man wirklich höhere Ambitionen hat.“
Was ist auf dem Weg in die Forschung und zu einer Professur wichtig? Sehen Sie hier Besonderheiten für die MINT-Fächer?
Die MINT-Fächer sind in jedem Fall finanziell sehr viel besser ausgestattet. Ich glaube, daher ist eine wissenschaftliche Laufbahn in dem Bereich sehr viel leichter als in den Sozial- und Geisteswissenschaften, wenn man sich einmal dafür entschieden hat. Dagegen schätze ich die Anfangshürde in MINT als sehr viel höher ein. Abstraktes und mathematisches Denken muss man wirklich mögen. Für Mathematik, Informatik, Ingenieurwissenschaften, auch Chemie, ist es das A und O.
Auf dem Weg in die Forschung sind zwei Dinge wichtig. Die spezielle Art des Denkens, sich die Welt verständlich zu machen, muss einem liegen. Ob das so ist, findet man tatsächlich erst im Laufe des Studiums heraus. Das zweite ist Durchhaltevermögen. Das lernt man ja im Studium, weil es in diesen Fächern schon währenddessen Durststrecken gibt. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frauenbeauftragten, die meinte: „Ich will den Frauen nicht immer sagen, dass sie sich durchbeißen müssen.“ Aber man muss sich durchbeißen, wenn man wirklich höhere Ambitionen hat. Das gilt nicht nur für die Professur, das gilt in der Industrie vielleicht sogar noch mehr.
„Wissenschaft gelingt nicht als Einzelperson, man braucht Unterstützung.“
Was würden Sie jungen Frauen empfehlen, die sich für eine wissenschaftliche Laufbahn in Ihrem Fach interessieren?
Diese Frage kann ich so allgemein nicht beantworten. Aber was ich im Umgang mit Promovierenden inzwischen wahrnehme, ist ein unglaublicher Optimierungsdruck. Der stürzt Menschen in Krisen, weil sie das Gefühl haben zu scheitern, wenn sie nicht alles perfekt machen. Ich denke es ist sinnvoller, Schritt für Schritt zu denken und dabei immer einen Plan B parat zu haben. Natürlich sollte man nicht nur das machen, was Spaß macht und worauf man Lust hat. Ein paar Kriterien sollten gut passen, aber es muss nicht auf das Maximum hin optimiert werden.
In den Naturwissenschaften sollte man international vernetzt sein, am besten durch längere Auslandsaufenthalte. Wenn das nicht geht, ist es kein Ausschlusskriterium, aber es macht das Leben deutlich komplizierter. Meine Betreuerin des Labors in Frankreich beispielsweise war zu dieser Zeit Koordinatorin eines europäischen Netzwerkes, das hat mir ganz viele Türen geöffnet. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist die passende Betreuung oder Arbeitsgruppe. Die Chemie muss stimmen. Man braucht das Gefühl, mit der Betreuerin oder dem Betreuer gut reden zu können. Wissenschaft gelingt nicht als Einzelperson und auch nicht im Kämmerlein. Man braucht die Unterstützung durch die Mentor*innen, vor allem in der Anfangszeit.
Die Fragen stellte Dr. Corinna Tomberger, Stellvertreterin der zentralen Frauenbeauftragten und Referentin im Team Zentrale Frauenbeauftragte; Mitarbeit: Angelina Uhl, studentische Mitarbeiterin im Team Zentrale Frauenbeauftragte.