Was ist eigentlich umweltschonender: Elektronisches Lesen oder doch der Griff zum gedruckten Bibliotheksbuch, das von vielen Nutzenden immer wieder gelesen werden kann? Diese Fragestellung beschäftigt die Nachhaltigkeits-AG der Universitätsbibliothek GreenFUBib seit langem und wird auch von Nutzenden immer wieder aufgeworfen. Lorenz Weinberg, Bibliotheksreferendar in der Universitätsbibliothek, hat sich auf die Suche nach neuen Studien und Erkenntnissen gemacht. Es gibt keine abschließenden Antworten – das Thema ist und bleibt komplex.
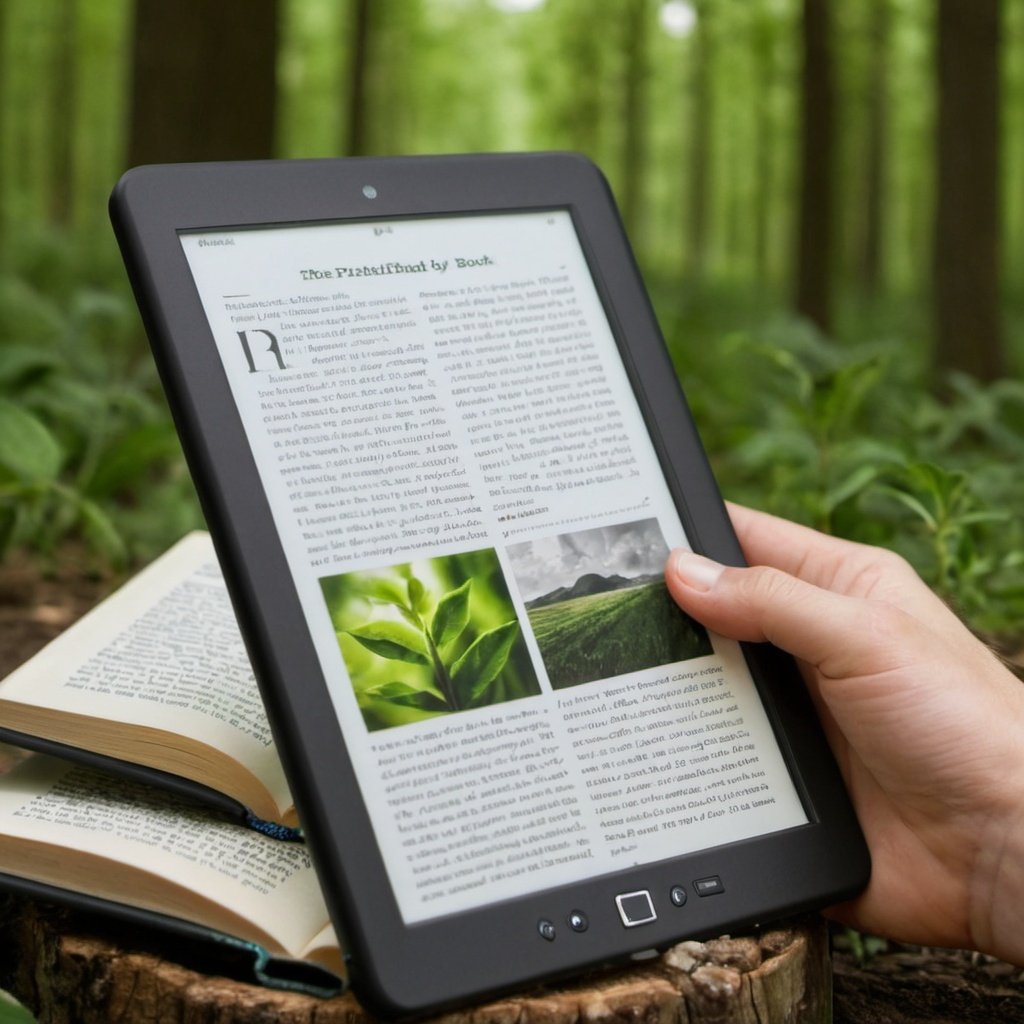
Studie und Masterarbeit als Ausgangspunkt
Ein erster Referenzpunkt ist eine Studie des Freiburger Öko-Institut e. V. aus dem Jahr 2011, in der die Umweltbilanz von E-Readern untersucht wurde. In der Studie „PROSA E-Book-Reader“ wurden Kriterien für das Umweltzeichen für klimarelevante Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Dem elektronischen Lesen auf E-Book-Readern wird das Prädikat ‚umweltfreundlich‘ verliehen und als Ergebnis festgehalten:
„Vielleser, die jährlich zehn oder mehr Bücher auf einem E-Book-Reader lesen, können damit zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Wer statt in gedruckten Büchern mit dem elektronischen Gerät schmökert, spart Papier, Energie und Treibhausgase.“
https://www.oeko.de/news/pressemeldungen/lesen-und-das-klima-schuetzen-mit-e-book-readern/
Die Schlussfolgerung, elektronisches Lesen sei ökologisch nachhaltiger als analoges Lesen, kann hieraus allerdings nicht gezogen werden. Vielmehr verlangt die Frage nach dem „nachhaltigen Lesen“ eine tiefgreifende und umfassende Beschäftigung mit dem Thema. So heißt es in der Studie und in der Zusammenfassung auf der Homepage zwar an verschiedenen Stellen, dass das digitale Lesen einer Nutzung von mindestens 10 Büchern pro Jahr und einer Nutzungsdauer des Endgeräts von mindestens 3 Jahren bezüglich Treibhausgasemissionen der Energieverbrauch des Endgeräts besser wäre, als gedruckte Bücher. Gleichzeitig wird diese Aussage aber bei genauerer Betrachtung innerhalb derselben Studie relativiert respektive korrigiert: Die Herstellung von 11 gedruckten Büchern verbrauche, so heißt es in der Studie, genauso viel Energie wie die Herstellung eines E-Book-Readers.
Der zweite Referenzpunkt ist die 2013 veröffentlichte Masterarbeit von Ulrike Wilke: Grüner lesen – Buch oder E-Book: Konzeption eines Bewertungssystems für nachhaltiges Leseverhalten. Wilke richtet den Fokus noch genauer auf die Art und Weise des Lesens und die Geräte, auf denen gelesen wird. In der Arbeit beschäftigt sie sich mit der Frage, welche Variante (E-Book oder gedrucktes Buch) zu welchem Leseverhalten aus ökologisch nachhaltiger Sicht am besten passt. Wilkes Kriterien für das „ökologische Lesen“ sind: „die Anzahl der gelesenen Medien (pro Jahr), die Beschaffenheit und Art des Endgerätes (E-Book-Reader, Tablets, PC usw.) sowie Leihgaben und Nutzungsdauer der Geräte (Buchkauf oder Buchverleih)“.
Wilke stellt die Ökobilanz und eine Nutzwertanalyse von E-Book-Readern, Tablets und Printbüchern auf und konzentriert sich dabei vor allem auf die Produktionszyklen dieser drei Produkte. Außerdem ermittelt sie den Einfluss des individuellen Leseverhaltens auf die Ergebnisse. Die Autorin kommt in ihrer Arbeit zu dem Ergebnis, dass insbesondere das individuelle Leseverhalten berücksichtigt werden muss, wenn die Ökobilanz des Lesens betrachtet werden soll. Die Anzahl der gelesenen Titel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Leider fehlen Betrachtungen auf Bibliotheksnutzende und Ausleihzahlen von Buchbeständen aus den Bibliotheken in ihren Betrachtungen.
Nachhaltig lesen in Bibliotheken? Eine Studie aus München
Lorenz Weinberg ist bei der Recherche auf den Artikel: „E-Books in Münchner Bibliotheken – Umweltfreundlich oder Klimakiller?“ von 2023 gestoßen.
Der Artikel kommt zu folgendem Ergebnis: „500 Buchseiten eines E-Books, die auf einem PC gelesen werden, sind ab dem 11. Nutzer umweltschädlicher als die 500 gedruckten Buchseiten in einer Bibliothek auszuleihen. Werden die 500 Seiten auf dem E-Book jedoch von allen Nutzern nur auf einem Tablet gelesen, so müssten die 500 Buchseiten schon von 148 Nutzern als gedrucktes Exemplar ausgeliehen werden, um umweltfreundlicher zu sein.“[1] Sprich, wenn gedruckte Bücher sehr oft (hier mehr als 148 Ausleihen) ausgeliehen werden, ist die Umweltbilanz eines gedruckten Buches besser, als die der elektronischen Ressource.
Unklar bleibt, um wie viel sich die Zahl der notwendigen Ausleihen erhöht, wenn die elektronische Ressource auf einem energiesparsamen eInk-E-Book-Reader gelesen wird. Außerdem sind die „anfallenden CO2-Emissionen für den Vertrieb, den Transport, die Lagerung und weitere Faktoren, durch die bei gedruckten Büchern CO2 entsteht“ sowie der Stromverbrauch für die Speicherung von elektronischen Ressourcen „in Rechenzentren sowie den Download der E-Books“ nicht miteingeflossen.[2]
[1] Warnke, Luka/Vorstenboch, Philip van de: E-Books in Münchner Bibliotheken – Umweltfreundlich oder Klimakiller? In: Story. Studierende. Online. Redaktion. Y. 07.02.2023. Online unter: https://story.unibw.de/campus/e-books-muenchner-bibliotheken-umweltfreundlich-oder-klimakiller (Letzter Abruf: 23.04.2024).
[2] Vgl., ebd.
Fazit
Der Artikel über die Münchener Bibliotheken verdeutlicht: Sobald ein Buch sehr häufig geliehen und von vielen Nutzenden gelesen wird, verbessert sich die Umweltbilanz eines gedruckten Buches in dem Maße, dass das gedruckte Buch aus ökologisch nachhaltiger Sicht zur besseren Wahl wird. Unter Berücksichtigung der Transportwege des gedruckten Buches (auch zur lesenden Person nach Hause) sowie der Einbeziehung von eInk-Readern, kann aber nach wie vor auch der Griff zum elektronischen Medium besser für die Umwelt sein. Dementsprechend kommt Lorenz Weinberg zu dem Schluss: Es ist kompliziert! Mit diesem Artikel möchte Lorenz Weinberg zum Nachdenken und Weiterforschen anregen und einige Ausgangspunkte dafür geben. In Zukunft bräuchte es konkrete, größer angelegte Studien zur Umweltbilanz von Printbüchern in Bibliotheken und eBook-Nutzung in Bibliotheken, um sich einer Antwort auf die Ausgangsfrage eindeutiger nähern zu können.
Text und Recherche:
Lorenz Weinberg, Bibliotheksreferendar der Universitätsbibliothek










