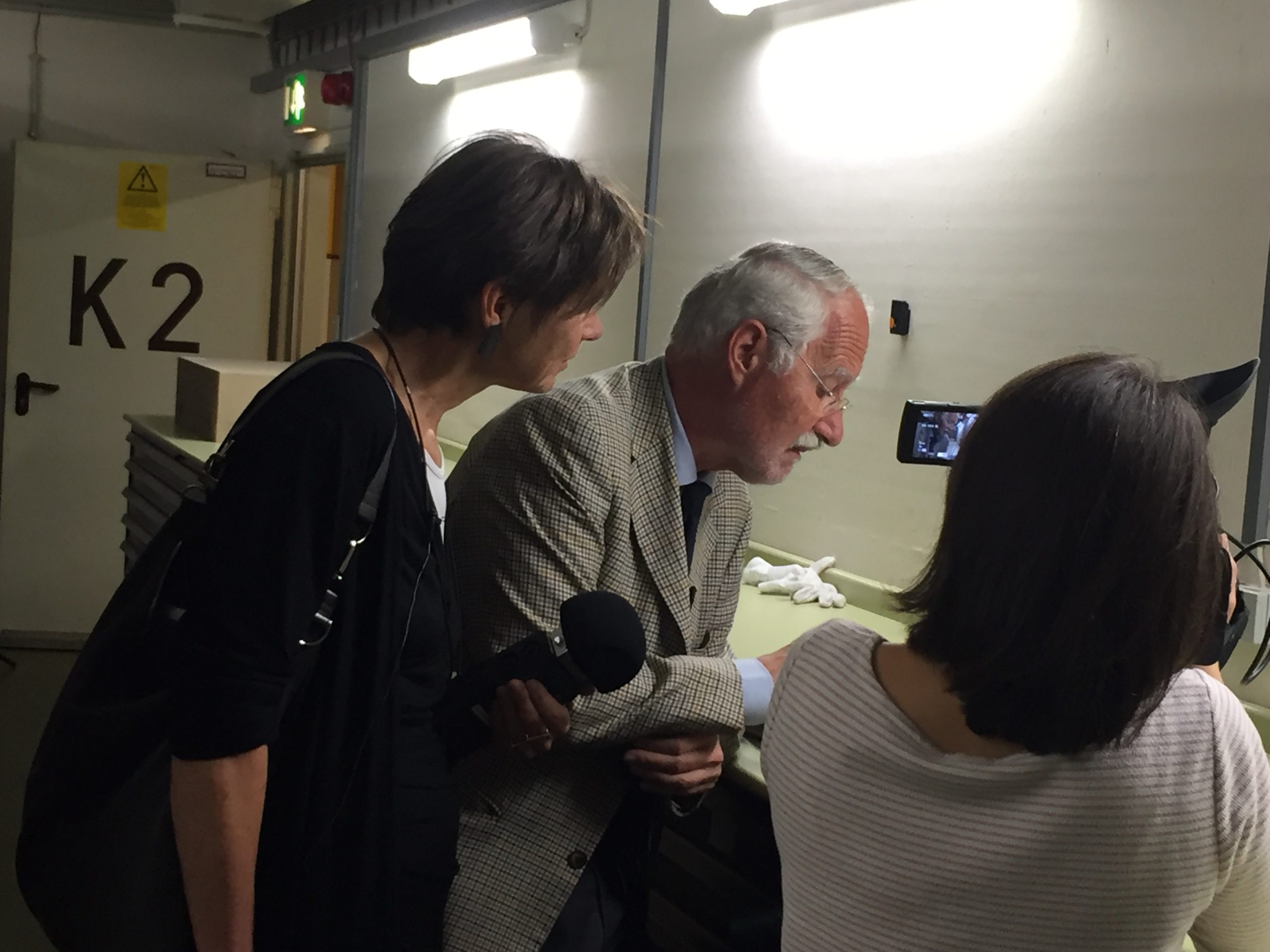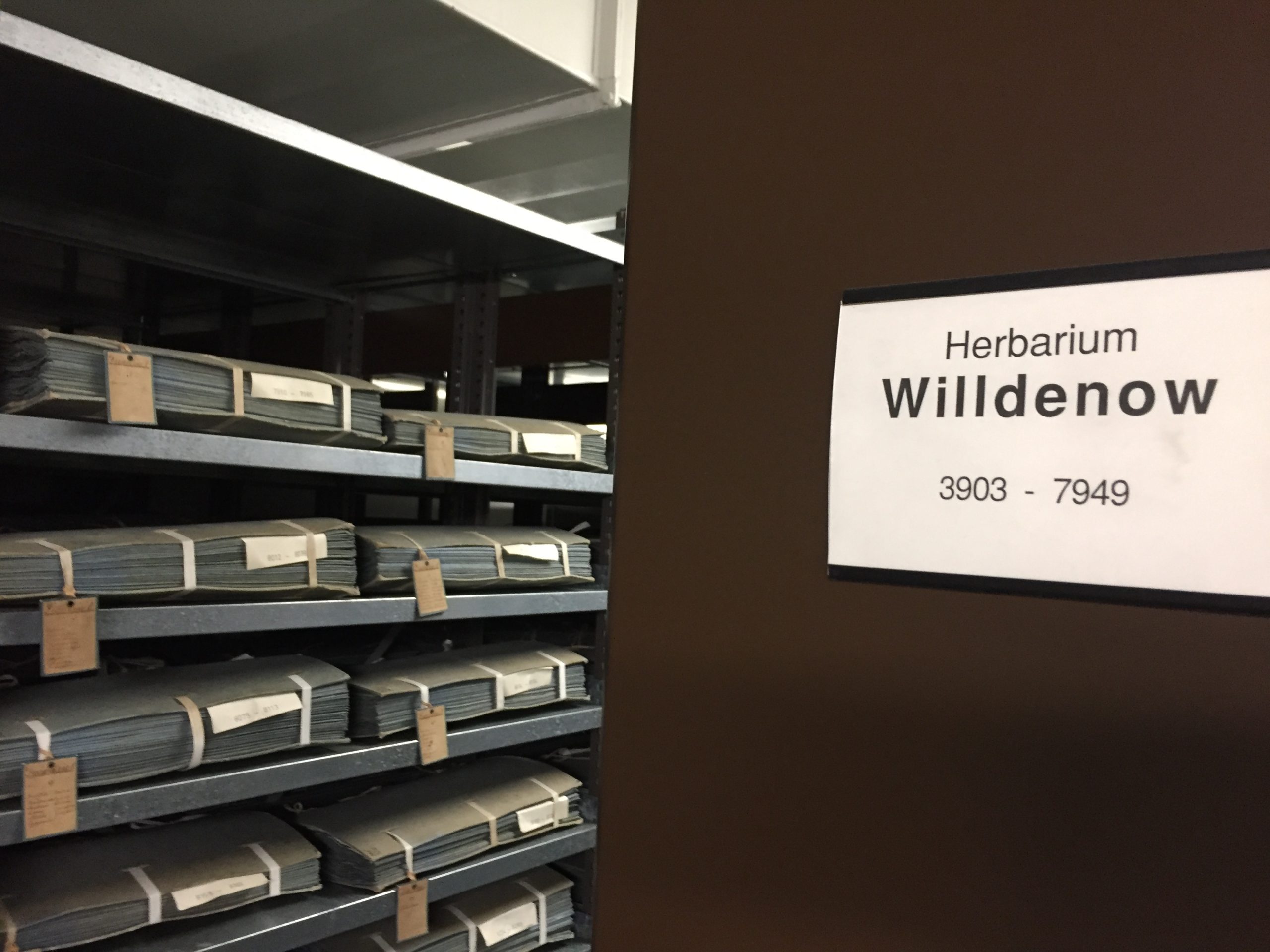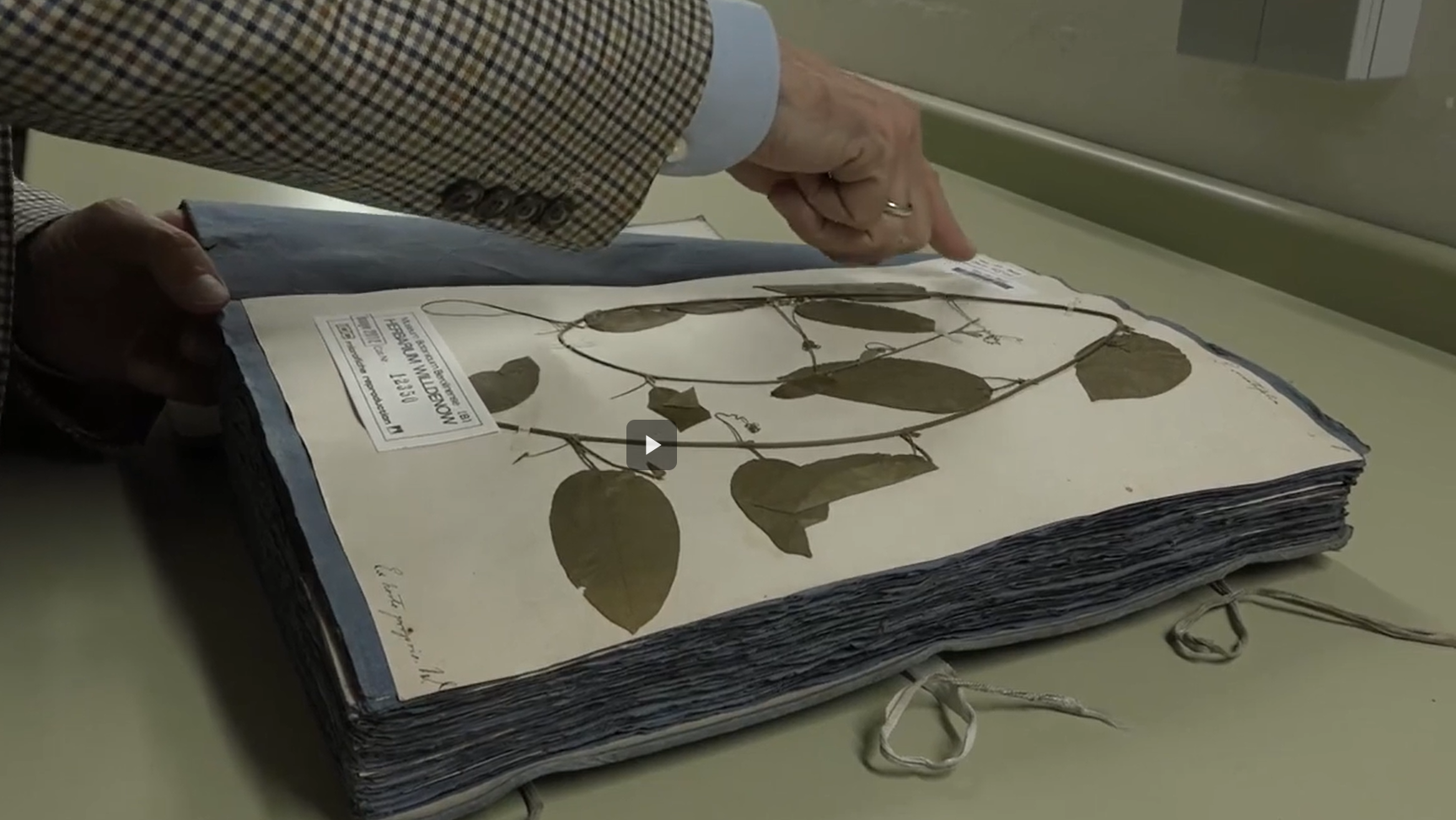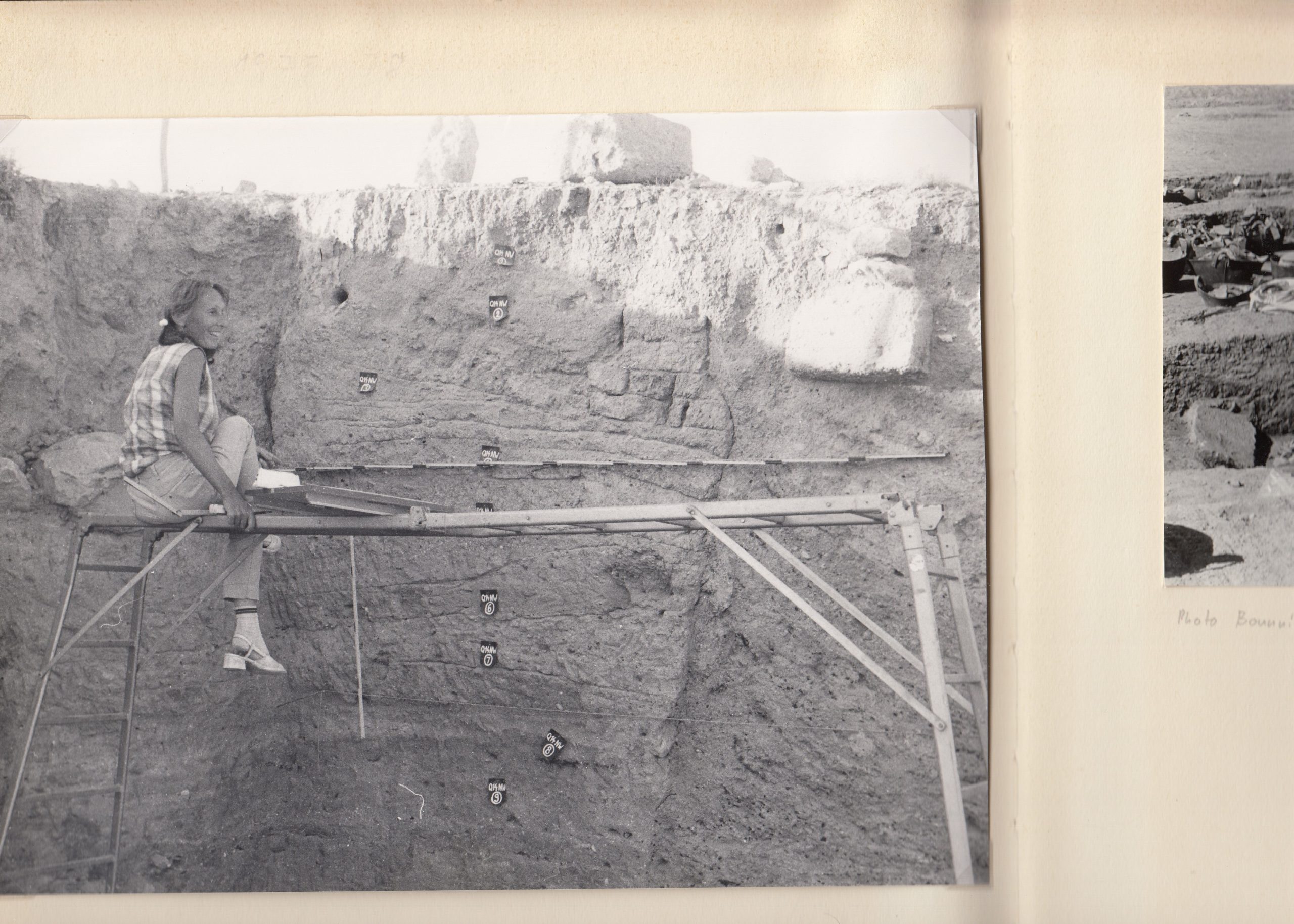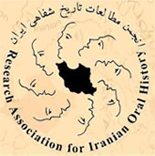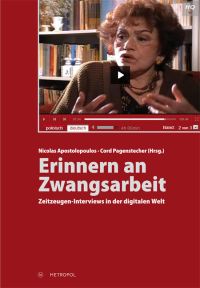Online-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945 Erinnerungen und Geschichte“ wird erweitert
Die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) präsentieren am Mittwoch, den 29.06.2022 um 16:00 Uhr im Rahmen einer Online-Veranstaltung eine neue Teilsammlung des Online-Archivs „Zwangsarbeit 1939-1945 – Erinnerungen und Geschichte“. Die Teilsammlung umfasst 40 Audio- und Video-Interviews ehemaliger Zwangsarbeiter*innen aus der West-Ukraine.
„Man ließ uns in Lwiw in solche Wagen einsteigen und nach zwei Tagen sind wir schon in Magdeburg angekommen. Niemand hat uns was zu essen gegeben. Ich glaube, erst in Halle oder in einer anderen Stadt irgendwo in Deutschland, hat man uns Kaffee zu trinken gegeben. Und dann hat man uns im Arbeitsamt verteilt.“
Wasyl S., Interview za534, 20.06.2006, Interview-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945“ https://archiv.zwangsarbeit-archiv.de/de/interviews/za534
Rund 600 Lebenserinnerungen von ehemaligen Zwangsarbeiter*innen des NS-Regimes aus 26 Ländern wurden in den Jahren 2005 bis 2006 in einem durch die FernUniversität Hagen koordinierten Interviewprojekt aufgezeichnet. Die Freie Universität Berlin hat diese Audio- und Video-Interviews inhaltlich erschlossen und stellt sie im Online-Archiv www.zwangsarbeit-archiv.de Schulen und Gedenkstätten, Forschenden und Interessierten zur Nutzung bereit. Transkripte, Übersetzungen, Fotos und Kurzbiografien sowie Expertengespräche ergänzen die Interviewsammlung.
Nun wird das Archiv um eine neu aufbereitete Teilsammlung von 40 Interviews erweitert, die sich dem besonderen Schicksal von Zwangsarbeiter*innen aus der West-Ukraine widmet.
Zwischen 1941 und 1945 leisteten etwa 2,4 Millionen Menschen aus der Ukraine Zwangsarbeit für das nationalsozialistische Deutschland. Etwa 350.000 von ihnen kamen aus den westukrainischen Distrikten. In den Interviews berichten 17 Frauen und 23 Männer über ihr Aufwachsen in der West-Ukraine, ihre Verschleppung zur Zwangsarbeit nach Deutschland oder über ihre Deportation in Konzentrationslager. Die zumeist in der Landwirtschaft und der Industrie eingesetzten Zwangsarbeitenden erinnern sich an die Bedingungen, unter denen sie zur Arbeit gezwungen wurden, an das Verhältnis zur deutschen Bevölkerung und an die schwierige Rückkehr nach Hause, wo sie häufig eine zweite Verfolgung erfuhren.
Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen russischen Angriffskrieges sind diese Lebensgeschichten eindrückliches Zeugnis der von Angriffen und Besatzung geprägten Geschichte der Ukraine.
Zur Präsentation der neuen Teil-Sammlung laden die Universitätsbibliothek der FU und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) alle Interessierten herzlich zu einer Online-Veranstaltung (via Webex) ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Teilnahme ist unter nachfolgendem Link möglich (verwendete Software: Cisco Webex):
https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin-en/j.php?MTID=md1a1c3397e0601844dd0c0bc73adb44c
PROGRAMM | Mittwoch, 29. Juni 2022
16:00 – 16:10 Uhr | Grussworte
Dr. Andreas Brandtner (Direktor der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin)
Dr. Sonja Begalke (Fachreferentin, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft)
16:10 – 16:30 Uhr | Projektrahmen und Online-Archiv
Dr. Doris Tausendfreund (Freie Universität Berlin)
16:30 – 16:50 Uhr | Historischer Kontext und drei biographische Beispiele
Dr. Kateryna Kobchenko (ehem. Freie Universität Berlin)
16:50 – 17:10 Uhr | Moderiertes Gespräch mit anschließender Diskussion
Verena Nägel (Freie Universität Berlin)
im Gespräch mit Lina Navrotska (Übersetzerin) und Dr. Nazarii Gutsul (Historiker)
Die Veranstaltung ist in deutscher Sprache. Sie wird aufgezeichnet.
Einladung zum Download (PDF)