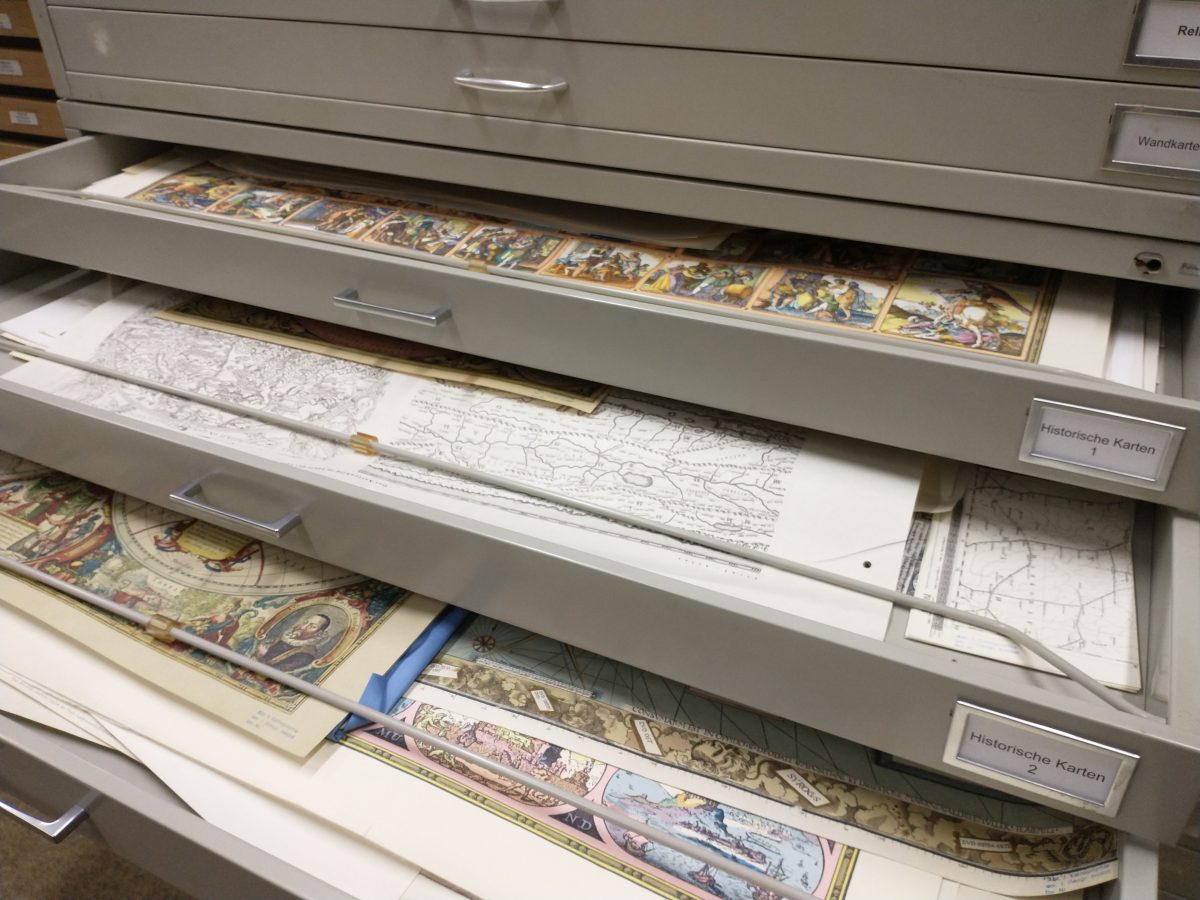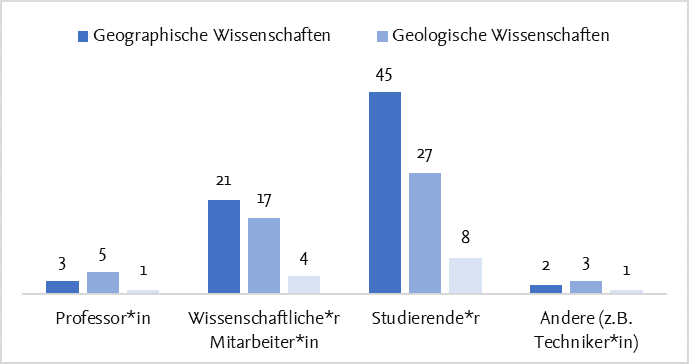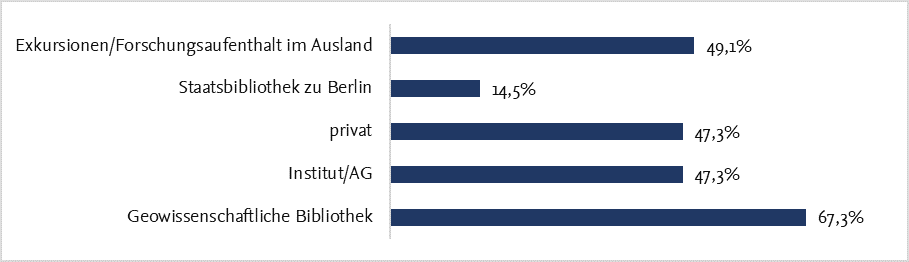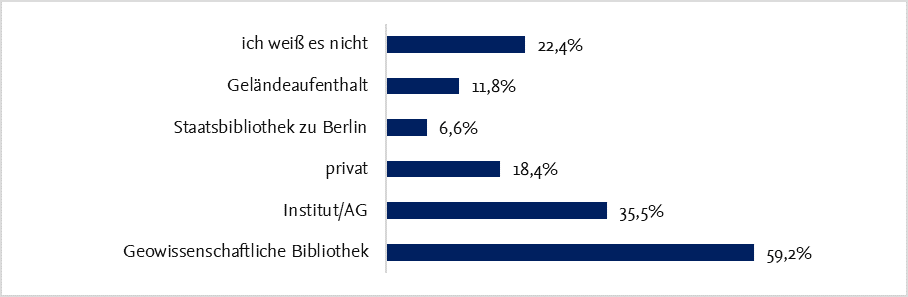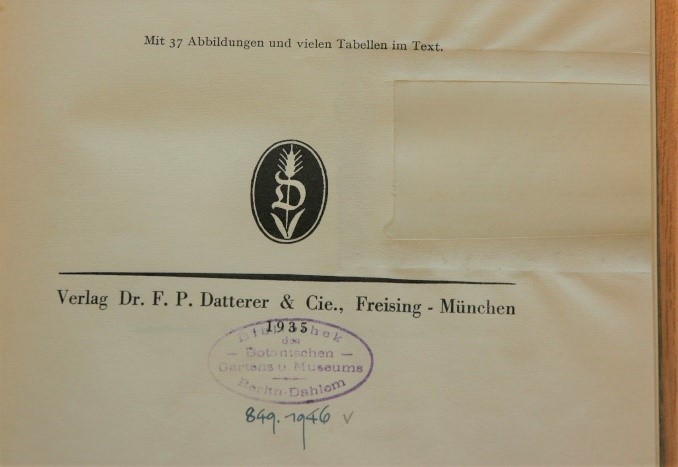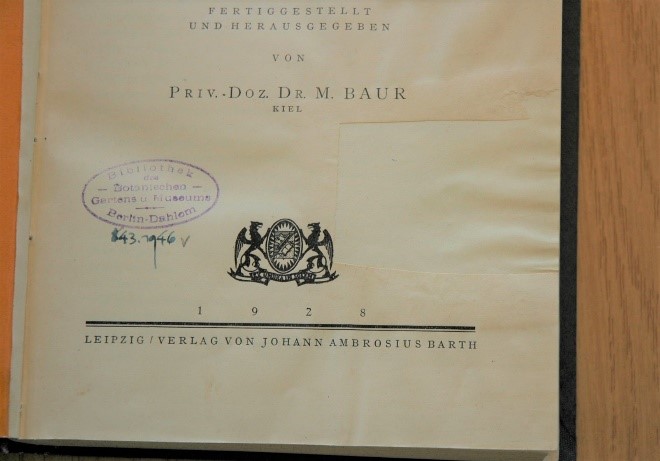Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Interviewportal Oral-History.Digital (oh.d) ist eine Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Sammlungen von audiovisuell aufgezeichneten narrativen Interviews.
Das Portal gibt Forschenden und historisch Interessierten Zugang zu bisher schwer zugänglichen Zeitzeug*innenen-Interviews aus unterschiedlichen Institutionen und Projekten: Als Erschließungsplattform unterstützt oh.d sammelnde Institutionen und Interviewprojekte bei der Archivierung, Erschließung und Bereitstellung ihrer audiovisuellen Forschungsdaten. Als Forschungsumgebung ermöglicht oh.d die sammlungsübergreifenden Recherche, Annotation und Auswertung von Zeitzeug*innen-Interviews.
Museen, Universitäten und Stiftungen können auf Oral-History.Digital ihre Audio- und Video-Interviews mit Transkripten und Begleitmaterialien hochladen, mit Werkzeugen für Transkription oder Verschlagwortung bearbeiten und für Bildung und Wissenschaft bereitstellen. Interessierte aus Forschung, Bildung und Öffentlichkeit können die Interviews über Filter- und Volltextsuche sammlungsübergreifend durchsuchen, mit Untertiteln ansehen, annotieren und zitieren.
Die Plattform wurde an der Universitätsbibliothek der Freien Universität in einem von der DFG geförderten Projekt gemeinsam mit zahlreichen Partner*innen konzipiert. Besonders eng war die Zusammenarbeit mit
- der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Lehrstuhl Medieninformatik),
- der FernUniversität in Hagen (Institut für Geschichte und Biographie),
- der FAU Erlangen-Nürnberg (Neuere und Neueste Geschichte),
- der Ludwig-Maximilians-Universität München (Bayerisches Archiv für Sprachsignale) und
- der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (Werkstatt der Erinnerung).
Darüber hinaus brachten über ein Dutzend Archive als Pilotnutzer*innen ihre Interviews, Erfahrungen und Anforderungen ein.
Am Montag, den 25. September 2023, 14:00 – 17:00 Uhr, wird das neue Portal der Öffentlichkeit vorgestellt. Zur Eröffnungsveranstaltung im Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin sind alle Interessierten herzlich eingeladen!
Eröffnungsveranstaltung – Programm
- 14:00 – 14:15 Uhr
Begrüßung und Grußworte
Prof. Dr. Günter Ziegler (Präsident der Freien Universität Berlin)
Dr. Andreas Brandtner (Leitender Direktor der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin) - 14:15 – 15:45 Uhr
Oral-History.Digital: Erschließungsplattform – Interviewportal – Forschungsdateninfrastruktur
Für das Projektteam: Dr. Cord Pagenstecher (Berlin), Dr. Almut Leh (Hagen), Prof. Dr. Andreas Henrich (Bamberg), PD Dr. Florian Schiel (München), Prof. Dr. Julia Obertreis (Erlangen). Moderation: Prof. Dr. Susanne Freund (Potsdam) - 15:45 – 16:15 Uhr: Kaffeepause
- 16:15 – 17:00 Uhr
Erlebte Geschichte: Eine Oral History der Freien Universität Berlin
Dr. Doris Tausendfreund (Freie Universität Berlin)
Wer nicht persönlich teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Eröffnungsveranstaltung über einen Live-Stream zu verfolgen. Sowohl für die Teilnahme in Präsenz als auch für den Live-Stream wird um Anmeldung unter https://www.oral-history.digital/eroeffnung/PM-anmeldung/index.html gebeten.
Zum Weiterlesen
Nähere Informationen zu Oral-History.Digital enthält auch die Pressemitteilung der Freien Universität vom 14. September 2023.
Einen Bericht zum Thema lesen Sie außerdem in der kommenden Ausgabe der Tagesspiegel-Beilage der Freien Universität Berlin, die am 8. Oktober 2023 erscheint.
Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel ist in leicht abgeänderter Form zuerst im Newsletter UBtoDate #2/2023 der Universitätsbibliothek erschienen. Newsletter abonnieren? Bitte hier entlang.