Ab sofort können über das FU-Campusnetz dauerhaft 8 literaturwissenschaftliche Datenbanken des Anbieters Gale genutzt werden. Deren Inhalte bieten u. a. Volltext-Zugriff auf über 250.000 Literaturkritiken, fast 500 Zeitschriften, mehr als 170.000 Biografien, 340.000 Primärquellen (u. a. Gedichte, Kurzgeschichten, Romane, Non-fiction) sowie über 800.000 Rezensionen aus Literatur, Film und Theater. Ausgewertet werden die Literaturen aller Epochen und Sprachen, mit einem Schwerpunkt auf den anglo-amerikanischen Kulturraum.
Die Datenbanken im Überblick:
- Literature Resource Center
 Die wahrscheinlich bekannteste der Datenbanken mit Informationen über Schriftsteller aller Zeiten und Länder, die u. a. in den Genres Fiktion, Nonfiktion, Lyrik, Drama, Geschichte und Journalismus geschrieben haben. Sie besteht aus den einzelnen Datenbanken: Contemporary Authors Online, Contemporary Literary Criticism Select sowie Dictionary of Literary Biography Online. Abgerundet wird das Angebot durch ein Sachwörterbuch der Literaturwissenschaft (Encyclopedia of Literature) sowie durch die im Volltext enthaltenen über eine Million Aufsätze aus 450 internationalen philologischen Fachzeitschriften und zahlreichen Aufsatzsammlungen.
Die wahrscheinlich bekannteste der Datenbanken mit Informationen über Schriftsteller aller Zeiten und Länder, die u. a. in den Genres Fiktion, Nonfiktion, Lyrik, Drama, Geschichte und Journalismus geschrieben haben. Sie besteht aus den einzelnen Datenbanken: Contemporary Authors Online, Contemporary Literary Criticism Select sowie Dictionary of Literary Biography Online. Abgerundet wird das Angebot durch ein Sachwörterbuch der Literaturwissenschaft (Encyclopedia of Literature) sowie durch die im Volltext enthaltenen über eine Million Aufsätze aus 450 internationalen philologischen Fachzeitschriften und zahlreichen Aufsatzsammlungen.
- Dictionary of Literary Biography
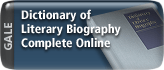 Über 16.000 Essays zu Autoren aller Epochen mit knappen bibliographischen Angaben. Der Schwerpunkt liegt auf dem anglophonen Raum, doch werden auch andere Literaturen in unterschiedlichem Maße berücksichtigt. Die Inhalte stammen neben dem Dictionary of Literary Biography aus der Dictionary of Literary Biography Documentary Series und dem Dictionary of Literary Biography Yearbook.
Über 16.000 Essays zu Autoren aller Epochen mit knappen bibliographischen Angaben. Der Schwerpunkt liegt auf dem anglophonen Raum, doch werden auch andere Literaturen in unterschiedlichem Maße berücksichtigt. Die Inhalte stammen neben dem Dictionary of Literary Biography aus der Dictionary of Literary Biography Documentary Series und dem Dictionary of Literary Biography Yearbook.
- Literature Criticism Online
 Zugriff auf ca. 220.000 kritische Essays über Leben und Werk von Schriftstellern der Antike bis in die Gegenwart, darunter Romanautoren, Dichter, Dramatiker, Journalisten, Philosophen, politische Führer, Wissenschaftler, Mathematiker und Autoren anderer Disziplinen aus aller Welt. Diese stammen aus zehn Buchreihen von Gale (aus lizenzrechtlichen Gründen besteht i. d. R. kein Zugriff auf Volltext-Artikel aus älteren Jahrgängen!).
Zugriff auf ca. 220.000 kritische Essays über Leben und Werk von Schriftstellern der Antike bis in die Gegenwart, darunter Romanautoren, Dichter, Dramatiker, Journalisten, Philosophen, politische Führer, Wissenschaftler, Mathematiker und Autoren anderer Disziplinen aus aller Welt. Diese stammen aus zehn Buchreihen von Gale (aus lizenzrechtlichen Gründen besteht i. d. R. kein Zugriff auf Volltext-Artikel aus älteren Jahrgängen!).
- LitFinder
 Enthalten sind literarische Werke und Sekundärliteratur sowie Informationen zu Autoren aller Zeiten und Länder. Die Datenbank enthält über 150.000 Gedichte, 800.000 Gedichtauszüge sowie Kurzgeschichten, Reden, Theaterstücke, Biografien, Werkzusammenfassungen und Bildmaterial.
Enthalten sind literarische Werke und Sekundärliteratur sowie Informationen zu Autoren aller Zeiten und Länder. Die Datenbank enthält über 150.000 Gedichte, 800.000 Gedichtauszüge sowie Kurzgeschichten, Reden, Theaterstücke, Biografien, Werkzusammenfassungen und Bildmaterial.
- Scribner Writer Series
 Zugriff auf 1600 von Experten verfasste Essays über Leben und Werk von Schriftstellern der Antike bis in die Gegenwart. Eingegangen wird auf Autoren aus 77 Ländern. Stark vertreten ist der angloamerikanische Sprachraum (u. a. durch die enthaltene American Writers Series), es finden sich aber auch Essays zu AutorInnen aus z. B. dem arabischen Raum, Afrika, Lateinamerika sowie aus Genres wie Mystery, Suspense, Science Fiction, Kinder- und Jugendliteratur.
Zugriff auf 1600 von Experten verfasste Essays über Leben und Werk von Schriftstellern der Antike bis in die Gegenwart. Eingegangen wird auf Autoren aus 77 Ländern. Stark vertreten ist der angloamerikanische Sprachraum (u. a. durch die enthaltene American Writers Series), es finden sich aber auch Essays zu AutorInnen aus z. B. dem arabischen Raum, Afrika, Lateinamerika sowie aus Genres wie Mystery, Suspense, Science Fiction, Kinder- und Jugendliteratur.
- Something About the Author Online
 Detaillierte Informationen zu Leben und Werk von Kinder- und Jugendbuchautoren sowie -illustratoren. Die über 290 Bände umfassende Reihe enthält ca. 20.000 Einträge und 30.000 Bilder. Ebenfalls enthalten ist die Something About the Author Autobiography Series (1986 ff.) mit Autobiografien und Werkverzeichnissen zu den Autoren.
Detaillierte Informationen zu Leben und Werk von Kinder- und Jugendbuchautoren sowie -illustratoren. Die über 290 Bände umfassende Reihe enthält ca. 20.000 Einträge und 30.000 Bilder. Ebenfalls enthalten ist die Something About the Author Autobiography Series (1986 ff.) mit Autobiografien und Werkverzeichnissen zu den Autoren.
- Twayne’s Authors Series
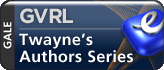 Inhalte von ca. 600 Büchern mit Informationen über Leben und Werk von Schriftstellern der Antike bis in die Gegenwart, inkl. Geschichte und Einfluss literarischer Strömungen und die Entwicklung verschiedener Genres. Jeder einzelne Titel ist zwischen 175 und 200 Seiten lang. Insgesamt werden Autoren aus 34 Ländern behandelt.
Inhalte von ca. 600 Büchern mit Informationen über Leben und Werk von Schriftstellern der Antike bis in die Gegenwart, inkl. Geschichte und Einfluss literarischer Strömungen und die Entwicklung verschiedener Genres. Jeder einzelne Titel ist zwischen 175 und 200 Seiten lang. Insgesamt werden Autoren aus 34 Ländern behandelt.
- Gale Literary Sources
 Online-Recherche-Portal, das die Inhalte aller sieben zuvor aufgeführten Datenbanken zusammenfasst.
Online-Recherche-Portal, das die Inhalte aller sieben zuvor aufgeführten Datenbanken zusammenfasst.


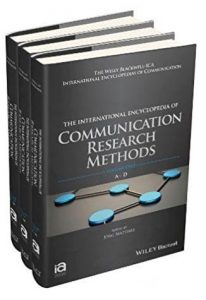
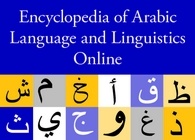

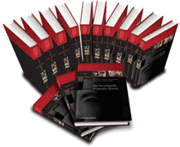
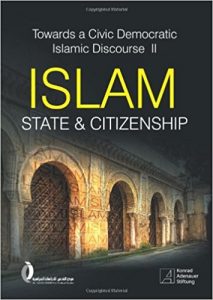
 Nach einem Test im letzten Jahr kann nun über das FU-Campusnetz dauerhaft auf
Nach einem Test im letzten Jahr kann nun über das FU-Campusnetz dauerhaft auf