Die Datenbank wurde ab April 2020 lizenziert.
 Bis zum 31. Mai 2019 kann im FU-Campusnetz kostenfrei Artfilms Digital getestet werden.
Bis zum 31. Mai 2019 kann im FU-Campusnetz kostenfrei Artfilms Digital getestet werden.
Artfilms Digital ist der Video-Streaming-Service von Contemporary Arts Media.
Contemporary Arts Media / Artfilms bietet seinen Service vor allem Bildungseinrichtungen an und ermöglicht den Zugriff auf derzeit mehr als 5000 Filme, Dokumentationen oder Interviews, vorwiegend in englischer Sprache, in einer großen thematischen Bandbreite.
Die Filme stammen aus Australien, Großbritannien, den USA, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Kanada, der Schweiz, Pakistan, Indonesien, Afrika und Japan.
Contemporary Arts Media arbeitet auch direkt mit Kunstschaffenden weltweit zusammen und beteiligt sich an Produktionen.
Sie möchten die Datenbank über das Testende hinaus nutzen? Dann lassen Sie uns einfach Ihre Bewertung zukommen!
 Ab sofort kann über das FU-Campusnetz auf die Gender Studies Collection von Duke University Press zugegriffen werden.
Ab sofort kann über das FU-Campusnetz auf die Gender Studies Collection von Duke University Press zugegriffen werden. Bis zum 8. Juli 2019 kann im FU-Campusnetz kostenfrei SZ Retro, der erweiterte Archivbestand der
Bis zum 8. Juli 2019 kann im FU-Campusnetz kostenfrei SZ Retro, der erweiterte Archivbestand der 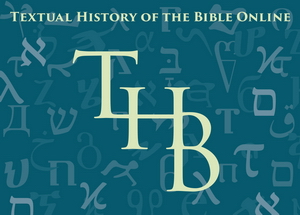
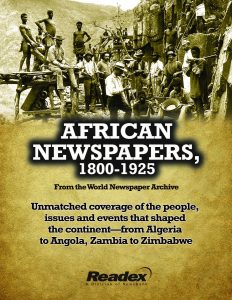
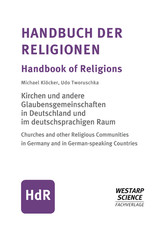
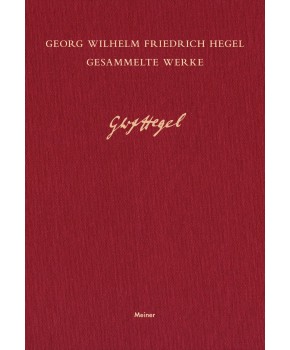
 Noch bis zum 24. Juni 2019 kann über das FU-Campusnetz kostenfrei auf die Collection
Noch bis zum 24. Juni 2019 kann über das FU-Campusnetz kostenfrei auf die Collection  Bis voraussichtlich 8. Juli 2019 kann über das FU-Campusnetz kostenfrei auf die Inhalte von
Bis voraussichtlich 8. Juli 2019 kann über das FU-Campusnetz kostenfrei auf die Inhalte von 